Hat Krimi «Das vierte Opfer» aus der Serie «Die Chefin» Gewalt verherrlicht und Jugendliche gefährdet?
3679 |
Mit Ihrem Brief vom 8. Oktober 2014 haben Sie die Ausstrahlung des Films „Das vierte Opfer“ der Serie „Die Chefin“ am 7. Oktober auf SRF kritisiert. Den Erhalt Ihrer Beanstandung habe ich mit meinem Brief vom 9. Oktober bereits bestätigt.
Wie üblich, habe ich die Verantwortlichen von SRF gebeten, zu Ihren Kritiken Stellung zu beziehen. Dies ist erfolgt und in der Zwischenzeit habe ich die von Ihnen geäusserten Kritiken analysieren können. Ich bin somit in der Lage, Ihnen heute meinen Schlussbericht zu senden.
1. Sie motivieren Ihre Reklamation wie folgt:
„Die genannte Ausstrahlung ist nach meinem Verständnis menschenverachtend und zeigt einmal mehr die Verherrlichung der Gewalt insbesondere gegen Frauen. Die Darstellung im Wald erinnert an das Ausweiden eines Wildtieres. Das mehrfach genannte Wort ausbluten unterstützte diesen Gedanken.
Auch wenn wir in der Schweiz Medienfreiheit haben, so darf doch nicht alles erlaubt sein! Um diese Sendezeit sind viele Jugendliche vor dem Fernsehen. Die krasse Darstellung von Gewalt wirkt ganz besonders auf diese Altersgruppe.“
2. Wie bereits erwähnt, haben die Verantwortlichen von SRF zu Ihren Kritiken Stellung bezogen. Herr Thomas Lüthi, Redaktor Fiktion, schreibt dabei Folgendes:
„Ich habe mir besagte Episode von ‚Die Chefin’ mit dem Titel ‚Das vierte Opfer’ zum dritten Mal angesehen, kritische Stellen mit dem Drehbuch verglichen. Zur Reklamation von Herrn X nehme ich als verantwortlicher Redaktor wie folgt Stellung:
Herr X kritisiert, dass in besagter Folge Gewalt verherrlicht wird. Duden und Strafgesetzbuch definieren Gewaltverherrlichung mit Begriffen wie exzessiv, folgenlos und menschenverachtend. Er moniert ausserdem, dass dem Jugendschutz nicht Folge geleistet wird. Ich bin der Ansicht, dass all das nicht auf ‚Das vierte Opfer’ zutrifft. Zu den einzelnen Punkten:
Gewaltdarstellungen: Es darf nicht ausser acht gelassen werden, dass es sich hier um einen Krimi handelt. Und wer sich einen Krimi anschaut, dessen ist sich Herr X sicherlich bewusst, muss mit Gewaltdarstellungen rechnen. Das gilt auch für ‚Das vierte Opfer’.
In der Episode jagt die Polizei einen Serientäter, der seine Opfer wie Schlachtvieh behandelt. Die grauslichen Taten werden nie im Bild gezeigt – weder indirekt, schon gar nicht explizit. Es gibt eine einzige kurze, halbtotale Einstellung, in der Gesicht und Körper eines Mordopfers zu sehen sind. Hinter ihr kniet die empathische Forensikerin. Die ermordete Frau hat Augen offen und Mund geschlossen. An ihrem Bein ist zwar eine Schnittwunde zu erkennen, doch weil diese am Bildrand fast zur Kameraeinstellung ‚hinausfällt’, wird der Zuschauerfokus wohl eher auf der Gesamtkomposition der Einstellung liegen, als auf der Wunde.
Fotos von Tatorten und Opfern sind zwar an drei Stellen deutlich zu sehen – bei Vernehmungen oder Diskussionen im Ermittlerteam –, aber ohne dass für den Zuschauer Details zu erkennen sind: Die Kamera bleibt hier auf Distanz oder rückt die Bilder in die Unschärfe.
Die aufwühlendste Szene der Episode – für mich, für meine Kolleginnen und Kollegen und wohl auch für Herrn X – kommt am Schluss. Der Serienmörder hat sich Sabine Heuchert, die junge Frau, die ihm am Anfang der Episode knapp entkommen ist, doch noch geschnappt. Er will gerade zur Tat schreiten und wird in letzter Sekunde von der Polizei gestoppt. Die Kamera wechselt hier mehrheitlich zwischen Grossaufnahmen des Opfers und Täters einerseits und der sich nähernden Polizei andererseits hin- und her. Das Messer ist nur aus der Distanz zu erkennen. Wohlgemerkt: Gezeigt wird – und zwar distanziert und grösstenteils indirekt – die Tatvorbereitung. Zur Tat selber kommt es nicht.
An zwei Stellen schlägt der Täter Menschen nieder. Auch hier verfährt die Inszenierung wie sie für einen Dienstagskrimi typisch ist: Sobald das Opfer getroffen ist, wird umgeschnitten. Die Wirkung des Gewaltaktes gemildert. Nach diesem Prinzip wird auch der einzige sichtbare Tod in der Episode inszeniert. Ein Verdächtiger nimmt sich das Leben: Wie er die Waffe ansetzt, ist kurz in der Unschärfe erkennbar. Die Schussabgabe erfolgt fast punktgenau auf dem Schnitt. In der Totale und im Gegenlicht fällt der Mann zu Boden. Es sind keinerlei Einzelheiten erkennbar.
Man möge mir bitte die detaillierte Auflistung der Gewaltszenen in der monierten Episode nachsehen. Aber sie ist meiner Ansicht nach nötig, um zu zeigen, wie umsichtig die Macher von ‚Die Chefin’ mit expliziten Gewaltdarstellungen umgehen. Sie gehen nicht über das für diesen Sendeplatz übliche Mass hinaus, sind im Vergleich zu anderen Krimiformaten – aus Deutschland, England, USA oder Skandinavien – vergleichsweise harmlos.
Aussergewöhnlich ist diese Episode im Bereich der Suggestion. Die Morde werden zwar nicht gezeigt, aber beschrieben – knapp und effektiv. Tatwaffen und sonstiges Werkzeug, z.B. Seile und Karabinerhaken sind sichtbar. Der Zuschauer erhält einen deutlichen Eindruck der Taten, des Tathergangs. Die Schlussszene, in der zwar wenig gezeigt und viel angedeutet wird, bewegt sich deshalb an der Grenze des für einen Dienstagkrimis noch Zumutbaren. An diesem Punkt finde ich Herrn Xs Ärger nachvollziehbar.
Die vom SRF koproduzierten ZDF-Krimiformate sind zwar in erster Linie als Unterhaltung für ein eher älteres Publikum konzipiert, müssen aber auch als Spiegel der Gesellschaft bzw. Gegenwart funktionieren. Dies aus Gründen der Plausibilität und Realitätsnähe. Und neben ‚normalen’ Mördern beschäftigt sich die Polizei halt auch mit Serientätern. Diesem Faktor tragen auch die Macher der ZDF-Krimis Rechnung. Doch entsprechende Fälle sind die klare Ausnahme, werden es auch bleiben. Eine Schlussszene wie in ‚Das vierte Opfer’ gibt es deshalb nicht oft. Aber sie scheint mir als Einzelfall legitim, auch auf diesem Sendeplatz.
Herr X schreibt auch, dass die Episode menschen- und frauenverachtend sei. Das pure Gegenteil ist der Fall. Die Situation, die psychische Verfassung des Opfers wird dem Publikum auf eine Weise vermittelt und näher gebracht, wie es in anderen Krimiformaten oft fehlt. Das wird nicht mit dem Holzhammer und Zeigefinger erzählt, sondern mit einiger Raffinesse.
In einem Nebenplot muss sich Kommissar Trompeter mit Sabine Heuchert, die dem Serientäter ja knapp entkommen ist, auseinandersetzen. Er interpretiert ihr Suchen nach seiner Nähe fälschlicherweise als Anbaggern, sie ist ihm lästig, er drückt ihre häufigen Anrufe weg. Trompeter ignoriert eine Tatsache, die dem Publikum ohne jegliche Ambivalenz deutlich gemacht wird. Sabine Heuchert ist durch den Anschlag auf ihr Leben traumatisiert, leidet an starken Ängsten. Und Trompeters Ignoranz kostet die junge Frau fast das Leben. Bezeichnend ist ihre erste Reaktion, nachdem sie in der Schlussszene losgebunden wurde: Sie geht wütend auf Trompeter los. Anhand eines Krimifalls wird so ein gesellschaftspolitisches Problem thematisiert. Nämlich dass Opfer von Gewalt (meistens Frauen) häufig allein gelassen, nicht ernst genommen werden.
Und schliesslich befürchtet Herr X auch, dass Jugendliche an dieser Episode Schaden nehmen könnten. Es ist zwar Tatsache, dass sich diese Altersgruppe wesentlich stärkeren Toback gewöhnt ist. Doch solche Binsenwahrheiten entbinden uns nicht von der Verantwortung gegenüber unserem Publikum. Der entsprechende Rahmen orientiert sich am RTVG: Um 20 Uhr beginnt das Hauptabendprogramm, das sich grundsätzlich an ein mündiges (bzw. beaufsichtigtes) Publikum richtet. Ab 20 Uhr können daher Sex, Gewalt und andere heikle Inhalte in Filmen und Serien vorkommen.
Auch wenn ich Herrn Xs Ärger angesichts der aufwühlenden Episode gut verstehe, finde ich trotzdem, dass die Kritik unberechtigt ist. Ich bitte darum, die Eingabe abzuweisen.“
3. Soweit die Stellungnahme der Verantwortlichen von SRF. Herr Thomas Lüthi argumentiert umfassend und plausibel, warum seiner Meinung nach Ihre Beanstandung abzuweisen sei. Dabei gibt er offen zu, dass die Schlussszene der von Ihnen namentlich kritisierten Krimifolge mit dem Titel „Das vierte Opfer“ sich „an der Grenze des für einen Dienstagskrimis noch Zumutbaren“ bewegt.
Geht es um meine eigene Beurteilung, so muss ich um Verständnis dafür bitten, dass ich nicht alle Folgen der Krimiserie „Die Chefin“ anschauen konnte. Aber nachdem ich die Folge mit dem Titel „Das vierte Opfer“ angeschaut habe, kann ich Ihre Kritik durchaus nachvollziehen. Vor allem die Schlusssequenz kann sicher als problematisch angesehen werden.
Wurde aber dadurch die Gewalt insbesondere gegen Frauen verherrlicht? Steht die Ausstrahlung zu Beginn des Hauptabendprogramms in Widerspruch mit den geltenden Vorschriften betreffend Jugendschutz? Diese an sich berechtigten Fragen abschliessend zu beantworten, ist für die Ombudsstelle nicht einfach. Denn die Umsetzung sowohl der rechtlichen Bestimmungen betreffend Gewalt sowie Jugendschutz lassen einen gewissen Interpretationsspielraum zu.
Nachdem ich den Dienstagskrimi „Das vierte Opfer“ analysieren konnte, teile ich Ihre Auffassung, wonach es bei dem von Hauptkommissarin Vera Lanz verfolgten Mörder um einen ausgesprochen menschenverachtenden Täter ging. Es sollte unbestritten sein, dass der von der Polizei gejagte Serientäter seine Opfer in besonders grausamer Art und Weise behandelt. Obwohl Gewalt an sich als eigentliches Merkmal zu sämtlichen Krimifilmen gehört, ist vor allem die Schlussszene auch für das Genre Krimi an der Grenze des Zulässigen zu betrachten.
Aus verschiedenen Gründen gelange ich aber zur Auffassung, wonach von Verherrlichung von Gewalt nicht die Rede sein kann. Zuerst einmal, weil bei der Beurteilung eines Werkes nicht so sehr auf einzelne Gewaltdarstellungen, sondern auf die Gesamtaussage des Filmes zu achten ist. Zwar wurde den Zuschauenden ein deutlicher Eindruck der Taten vermittelt und die Morde wurden, wenn nicht gezeigt, doch umfassend beschrieben. Doch mit expliziten Gewaltdarstellungen wurde umsichtig umgegangen. Gewalt wurde nie ästhetisiert und seine Folgen immer als abstossend dargestellt. Der Betrachter – und dies scheint mir entscheidend zu sein – identifiziert sich stets mit den Opfern und nie mit dem Täter.
Auch bezüglich Jugendschutz ermöglichen die rechtlichen Bestimmungen einen nicht zu unterschätzenden Spielraum. Art. 5 des Radio- und Fernsehgesetzes sieht vor, dass die Programmveranstalter „durch die Wahl der Sendezeiten oder sonstige Massnahmen“ dafür zu sorgen haben, dass Minderjährige nicht mit Sendungen konfrontiert werden, welche „ihre körperliche, geistig-seelische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden“. Die entsprechende Verordnung ist etwas verbindlicher. Art. 4 Jugendschutz sieht vor, dass „jugendgefährdende Sendungen akustisch anzukündigen oder während ihrer gesamter Sendedauer mit optischen Mitteln zu kennzeichnen“ sind.
Die „SRF-Jugendschutzrichtlinien“ übernehmen und präzisieren diese gesetzlichen Leitplanken. Sie sehen insbesondere Folgendes vor: „Aus Rücksicht auf Kinder und Jugendliche sowie die Sensibilität des breiten Publikums wird generell dafür gesorgt, dass die ZuschauerInnen von SRF möglichst nicht ungewollt mit fiktionalen Darstellungen von Sex, Gewalt oder anderen heiklen Inhalten konfrontiert werden, die für sie nicht geeignet sind bzw. an denen sie Anstoss nehmen könnten. Dies wird zum einen mit der zeitlichen Platzierung der Sendungen im Programm und zum andern mit akustischen und visuellen Warnungen erreicht.“
Die SRF-Richtlinien präzisieren zudem, dass SRF tagsüber und am Vorabend im Allgemeinen Filme und Serie ausstrahlt, die auch für Kinder unter 12 Jahren unbedenklich sind. Um 20 Uhr beginnt das Hauptabendprogramm, das sich grundsätzlich an ein mündiges (bzw. beaufsichtigtes) Publikum richtet. „Ab 20 Uhr können daher Sex, Gewalt und andere heikle Inhalte in Filmen und Serien vorkommen, wobei die Programmverantwortlichen darauf achten, dass entsprechende Szenen einem Prime-Time-Publikum ab 12 Jahren zugemutet werden können.“
Wie Sie sehen, lassen auch die SRF-Jugendschutzrichtlinien einen gewissen Ermessenspielraum zu. Zudem können die Hauptfragen – Wer entscheidet, ob ein Film für Jugendliche nicht geeignet ist? Ab welchem Alter kann ein Film freigegeben werden? – nicht abschliessend beantwortet werden. Zwar sehen die Richtlinien vor, dass sich SRF bei der Einstufung von Spielfilmen grundsätzlich an die Altersfreigaben im Schweizer Kino zu halten hat. Doch bis zum 1. Januar 2013 wurden die Altersfreigaben für Kinofilme von Kanton zu Kanton unterschiedlich festgelegt. Erst ab diesem Datum ist die Vereinbarung über eine „schweizerische Kommission Jugendschutz im Film“ in Kraft getreten. Wie die SRF-Richtlinien auch, orientiert sich diese Kommission hauptsächlich an bestehenden Entscheiden der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) in Deutschland.
Geht es nun um die Krimireihe „Die Chefin“, hat diese Kommission laut meinen Recherchen keine Empfehlungen abgegeben. Die Deutsche FSK dagegen hat acht Folgen der Krimireihe bewertet. Sechs davon wurden ab 12 Jahren freigegeben, zwei dagegen erst ab 16 Jahren. Leider wurde keine der zehn von SRF gesendeten Folgen bewertet. Man kann aber davon ausgehen, dass auch die Krimis der Serie „Die Chefin“ und insbesondere die Folge „Das vierte Opfer“ gleich bewertet würden.
Kann man deshalb zur Schlussfolgerung gelangen, wonach die geltenden Vorschriften und Richtlinien verletzt wurden? Auf Grund der erläuterten Ausgangslage sowie meiner Einschätzungen über die gesehene Folge fände ich eine solche Kritik übertrieben.
Insgesamt gelange ich somit zur Auffassung, wonach die Ausstrahlung des Krimis „Das vierte Opfer“ zu Beginn des Hauptabendprogramms von SRF 1 die geltenden Bestimmungen über Gewalt sowie Jugendschutz nicht verletzt hat. Auch wenn ich Ihre kritische Reaktion durchaus verstehe und respektiere, kann ich Ihre Beanstandung, soweit ich darauf eintreten konnte, nicht unterstützen.
4. Ich bitte Sie, das vorliegende Schreiben als meinen Schlussbericht gemäss Art. 93 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes RTVG entgegenzunehmen. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI (Monbijoustrasse 54A, Postfach 8547, 3001 Bern) orientiert Sie der beiliegende Auszug aus dem Bundesgesetz über Radio und Fernsehen.
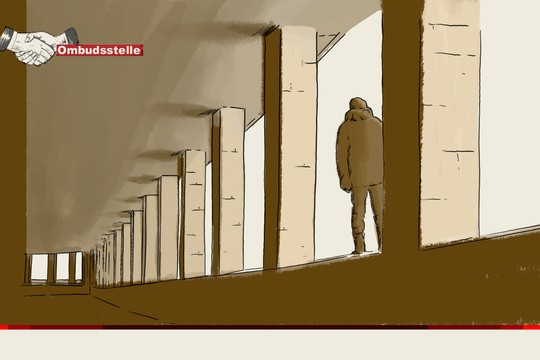


Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.