Die «vierte Gewalt» schwächelt

Die Medien gelten als die vierte Gewalt im demokratischen Staat. In Zeiten der «alternativen Fakten» und der «Fake News» ist das nicht mehr selbstverständlich. Warum also sind freie Medien so wichtig für eine Demokratie? Was unterscheidet überhaupt freie Medien von unfreien?
Direkte Demokratie ist anstrengend – das wissen alle, die sich schon durch die Vorlage zum Bau eines Schulhauses, zur Sanierung der Kläranlage oder zur Umsetzung eines Verfassungsartikels gelesen haben. Wer sich seriös mit der Abstimmung auseinandersetzen will, braucht häufig einiges an Informationsmaterial, bis er/sie sich eine eigene Meinung machen kann. Informationsmaterial, das von allen erdenklichen Seiten kommt, damit sich ein möglichst vollständiges Bild ergibt. Erst nachdem man vieles gelesen und mit anderen diskutiert hat, bildet man sich eine Meinung und geht abstimmen. Das Gros dieser Infos kommt auch heute noch aus den klassischen Medien: aus Tageszeitungen, Radio und Fernsehen. Die längst nicht mehr «neuen» Medien holen zwar auf, doch langsamer, als die Berichterstattung vermuten liesse. Das belegt eine aktuelle Studie der Uni Fribourg, die im Auftrag der Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-Swiss) die Rolle der Medien im politischen Machtpoker untersucht hat.
Neben Suchanfragen (vor allem bei Google) spielen die sozialen Medien, hauptsächlich Facebook und Twitter, eine wachsende Rolle im Buhlen um die Abstimmenden. Hier tobt der Kampf um die Deutungshoheit. Denn in den sozialen Medien kann posten, wer will. Was auch immer, jederzeit, beliebig oft. Niemand kontrolliert, ob die verbreiteten «Fakten» belegt sind. Im Gegenteil: Je reisserischer Facebookbeiträge oder Twitterzeilen formuliert sind, desto grösser sind die Chancen, dass diese per Algorithmus in die grosse weite Welt der Netzwerke gespült werden. Wie stark auf diese Weise kleine Gruppierungen in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung katapultiert werden können, zeigen die sogenannten Interaktionsraten: Die stramm rechte Internetseite «Breitbart» etwa wird über die sozialen Medien in den USA 20 Mal mehr geteilt und geliket als die «New York Times» und das «Wall Street Journal», obwohl die Seite selbst nur halb so viele Aufrufe erzielt wie die der beiden Zeitungen.
«Neben Suchanfragen (vor allem bei Google) spielen die sozialen Medien, hauptsächlich Facebook und Twitter, eine wachsende Rolle im Buhlen um die Abstimmenden.»
In der Schweiz sind die Verhältnisse ähnlich gelagert, wenn auch noch nicht im Internet: Auch hier erreichen professionelle Aufreger wie Christoph Blocher, die «Arena» oder die «Weltwoche» mehr öffentliches (Medien-)Echo, als ihnen nach der Grösse ihrer «Community» eigentlich zustehen würde.
Auch bei uns entsteht dadurch ein verzerrtes Bild des gesellschaftlichen Mainstreams. «Mainstream» wiederum ist, neben der vermeintlichen «Elite», eines der neuen Lieblingswörter der «neuen Rechten». Dabei schwingt mit, dass der «Mainstream» von «oben» (der Elite) gelenkt sei – und deshalb Lügen verbreite. Das ist an Absurdität kaum zu überbieten und untergräbt trotzdem (und bewusst) die Glaubwürdigkeit jeder traditionellen journalistischen Recherche. Dabei ist doch gerade das der grosse Unterschied zu den von privater – und oft politischer – Seite finanzierten Interessenspublikationen und Blogs: Während jene veröffentlichen, was ihnen die Geldgeber im Hintergrund diktieren, wird ein nach journalistischen Regeln verfasster Text nicht nur gründlich recherchiert, sondern auch durch die «Zwei-Quellen-Regel» (eine Behauptung wird von mindestens zwei voneinander unabhängigen Quellen bestätigt) abgesichert, er wird möglichst neutral verfasst und bei Anschuldigungen erst veröffentlicht, nachdem der kritisierten Person oder Institution die Möglichkeit gegeben wurde, Stellung zu beziehen. So steht es unter anderem in der «Erklärung der Pflichten und Rechte», die alle Journalisten unterschreiben müssen, wenn sie ins Berufsregister eingetragen werden wollen.
Noch halten sich die meisten Medien in der Schweiz an diesen Ehrenkodex. Diese Art von Journalismus kostet allerdings Zeit – und darum auch Geld, von dem im Zuge der Medienkrise immer weniger zur Verfügung gestellt wird. Gestresste Journalisten und Journalistinnen haben weniger Zeit für die Recherche, werden unachtsam und begehen eher Fehler. Durch die ständigen Sparmassnahmen bei den Zeitungen und Zeitschriften, die «Restrukturierung» und Zusammenlegung der dezimierten Redaktionen entsteht ein dünnfädiger Einheitsbrei, der dem Ansehen der Medien zusätzlichen Schaden zufügt, während gleichzeitig die Informationsmöglichkeiten im qualitativ unkontrollierbaren Internet ins schier Unermessliche gewachsen sind.
Um die Ursache für die Krise der Printmedien nicht alleine überwinden zu müssen, haben die grossen Verlagshäuser einen gemeinsamen Feind gesucht, der an ihrer Misere schuld sein soll. Gefunden haben sie die SRG SSR, die dank Gebührengeldern tatsächlich unabhängig von den Interessen privater Geldgeber ist und darum vom ständigen Abbau noch weitgehend verschont blieb. Und während die SRG dank ihrer audiovisuellen Inhalte zu den potenziellen Gewinnerinnen in der veränderten Medienlandschaft gehört, haben die Verlagshäuser die Digitalisierung zunächst verschlafen. Dafür träumt die Verlegerseite jetzt vom «Open Content»: Um den Wettbewerb zu ihren Gunsten zu «entzerren», wollen die privaten Medienhäuser von der SRG produzierte Inhalte gratis übernehmen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Gebührenzahler (also wir alle) für die Produktion audiovisueller Artikel bezahlten, die die Tamedia und Co. dann auf ihren Websites (von tages-anzeiger.ch bis ricardo.ch) über Paywalls und Werbegelder «kommerzialisieren» könnten und so quasi an die Gebührenzahler zurückverkaufen würden. Und das Geld, das wir doppelt zahlen, würde aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in die Redaktionen investiert, sondern flösse in die Taschen der Aktionäre.
«Die eigentliche Frage geht weit über die SRG hinaus – es geht vielmehr um die Zukunft der Informationsfreiheit und -vermittlung.»
Doch die eigentliche Frage geht weit über die SRG hinaus – es geht vielmehr um die Zukunft der Informationsfreiheit und -vermittlung. Um eine vielfältige Medienlandschaft zu garantieren, müssen die Arbeitsbedingungen im privat finanzierten Journalismus endlich wieder verbessert werden. Darum kämpfen Gewerkschaften und Berufsverbände seit Jahren um einen Gesamtarbeitsvertrag, der die Mindestbedingungen etabliert, die es für einen demokratierelevanten Journalismus braucht. Nun muss sich auch die Anhängerschaft einer unabhängigen und möglichst vielfältigen Medienlandschaft organisieren, denn es geht um die Verteidigung der Informationsfreiheit für uns alle.
Nina Scheu ist Mediensprecherin von syndicom,– der Gewerkschaft Medien und Kommunikation. Die Gewerkschaften der Schweizer Medienschaffenden setzen sich dezidiert für ein Nein zur «No Billag-Initiative» ein. Dieser Artikel erschien erstmals am 10. März 2017 in «syndicom» Nr. 2/2017.


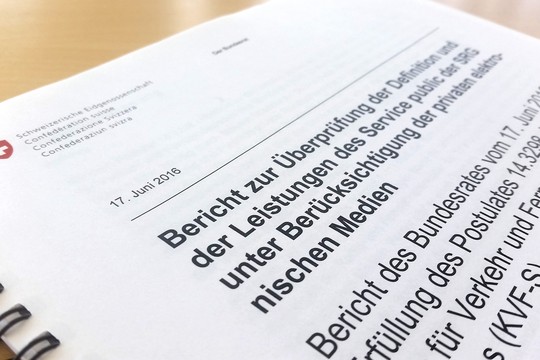
Kommentar