Mit öffentlichen Geldern den Zeitungen helfen

120 Millionen aus der Bundeskasse für die Verbilligung der Zeitungszustellungen – 90 Millionen mehr als bisher: Das verlangen die Verleger. Politisch hat das Begehren Chancen – Kritik gibt es dennoch.
Die Finanzierung des Journalismus steht auf einer unsicheren Basis. Soll der Staat Medien also fördern – und wie? In der Bundesverfassung sind Radio und Fernsehen geregelt – nicht aber die Presse. Entsprechend haben die Gebühren für Radio und TV eine verfassungsrechtliche Grundlage. Eine solche fehlt jedoch für eine Presseförderung durch den Bund.
«Rücksicht auf andere Medien»
Die Schweiz hat ein duales Mediensystem: der Rundfunk als Service public und die Presse im Markt. Das hatte der Gesetzgeber auch bei der Formulierung des Verfassungsartikels für den Rundfunk vor Augen. Deshalb ist in Artikel 93 BV zu Radio und TV formuliert: «Auf die Stellung und die Aufgabe anderer Medien, vor allem der Presse, ist Rücksicht zu nehmen.»
«Rücksicht» also, aber keine Unterstützung. Bei der Presseförderung möglich ist allerdings ein indirekter Weg: Der Bund hatte bereits 1849 via Postgesetz festgelegt, dass die Postzustellung von Zeitungen verbilligt erfolgen muss. Wie die Tarife berechnet werden, wie viel diese Verbilligung ausmachen soll, darüber wurde immer wieder verhandelt und auch gestritten. Aktuell resultiert für die Zeitungsverleger eine indirekte Unterstützung für Tages- oder Wochenzeitungen von 30 Millionen Franken. Eine weitere indirekte Förderung der Presse stellt der reduzierte Satz bei der Mehrwertsteuer dar – damit gehen der Bundeskasse etwa 75 Millionen verloren.
0.5 Mia CHF Umsatzverlust
Den Zeitungen geht es seit einigen Jahren schlecht, sie verlieren massiv an Anzeigen und auch an Abonnentinnen und Abonnenten. Gemäss Manuel Puppis, Professor für Media Systems and Media Structures an der Universität Fribourg, haben die Kaufzeitungen in der Schweiz beim Umsatz aus dem Werbegeschäft etwa eine Milliarde Franken verloren. Die neuen Einnahmen aus der Onlinewerbung machen hingegen nur gerade acht Prozent dieses Verlustes wett. Die Folgen sind bekannt: Schliessung von Zeitungen, Abbau in den Redaktionen, Konzentration bei den Titeln und bei den Besitzverhältnissen. Dieser Druck auf die Ressourcen des Journalismus kann auch die demokratiepolitisch notwendigen Leistungen der Medien gefährden. Und so ist auch die Politik herausgefordert.
Generelle Förderung?
Diese wirtschaftliche Krise im Pressesektor ist strukturell. Das über viele Jahre erfolgreiche Geschäftsmodell ist definitiv eingebrochen. Niemand wagt sichere Finanzierungsalternativen zu formulieren. Deshalb wird jetzt in breiteren politischen Kreisen diskutiert, ob nicht eine generelle Medienunterstützung durch den Staat notwendig sei. Bisher war eine solche Förderung politisch ohne Chancen. Zuletzt im März 2005 hat das eidgenössische Parlament abgelehnt, einen entsprechenden Artikel zur Presseförderung in die Bundesverfassung aufzunehmen.
Neue Töne der Verleger
Lange haben auch die Verleger selbst staatliche Fördermassnahmen als unnötig bezeichnet – der Markt funktioniere, solange er nicht durch unnötige Regulierungen eingeschränkt werde. Jetzt hat der Verlegerverband eine neue Botschaft an die Politik formuliert – prominent in der Rede ihres Präsidenten zum Auftakt des medienpolitischen Jahres 2019: Er verlangt, dass die Postzustellung der Zeitungen mit neu 120, statt wie bisher 30 Millionen, verbilligt werden soll – mit öffentlichen Geldern. Der Verlegerverband bleibt damit auf seiner Linie, lediglich indirekte Förderung zu verlangen: Also Gelder für die Postzustellung und keine direkten Zahlungen an die Medienhäuser. Dieses System entlastet ökonomisch alle Zeitungshäuser – je nach Auflagen in unterschiedlicher Höhe. Doch auch im Vorstand des Verlegerverbands gibt es inzwischen Stimmen, so etwa Peter Wanner (AZ Medien), die sich auch direkte Fördermassnahmen zugunsten der Presse vorstellen können.
Ist eine Förderung der Zeitung 2019 angesichts der Digitalisierung der Medienwelt noch zeitgemäss und nachhaltig?
Grosse Diskussion
Die aktuelle Forderung nach weiteren 90 Millionen für die indirekte Förderung hat politisch gute Chancen: So hat sich bereits der Präsident der CVP, Gerhard Pfister, prominent dafür stark gemacht. Dennoch stellen sich kritische Fragen: Ist es richtig, dass diese Unterstützung mit Steuergeldern auch an Medienhäuser geht, die insgesamt sehr hohe Gewinne machen? Und grundsätzlicher: Ist eine Förderung der Zeitung 2019 angesichts der Digitalisierung der Medienwelt noch zeitgemäss und nachhaltig? Ja sagt zum Beispiel Gerhard Pfister in einem Vortrag vor den Verlegern. Er setze auf «kleine, temporär wirksame Massnahmen». Anders sahen das im Jahre 2010 die staatspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat: Sie verlangten die Ausarbeitung eines neuen Modells für die Presseförderung. Und die Eidgenössische Medienkommission EMEK beurteilte 2014 die «staatliche Förderung der Mediengattung Print in Form von Posttaxenverbilligung» sogar als «nicht mehr zeitgemäss», weil der Transformationsprozess zur digitalen Medienwelt unumkehrbar sei. Sie empfiehlt, den «sukzessiven Abbau der bestehenden Posttaxenvergünstigungen (...) zugunsten anderer Instrumente zu überprüfen». Die politischen Reaktionen auf diesen Vorschlag der EMEK waren allerdings vorwiegend negativ.
Wer bezahlt?
Für die Erhöhung des Bundesbeitrags an die Posttaxenverbilligung braucht es eine Gesetzesänderung, die Kompetenz liegt also bei den eidgenössischen Räten. Der Verlegerverband regt an, zu prüfen, ob die zusätzlichen 90 Millionen statt über das Postgesetz, also direkt aus der Bundeskasse, über das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) und damit über die Gebühren finanziert werden könnten. Dafür könnte der sogenannte Gebührenüberschuss aus den Haushaltsabgaben für Radio und TV verwendet werden – ohne die Leistungen für die SRG und den privaten Rundfunk zu kürzen. Ob Postgesetz oder RTVG: Bis zur Umsetzung eines entsprechenden Begehrens auf Gesetzesebene muss man mit zwei bis drei Jahren rechnen.

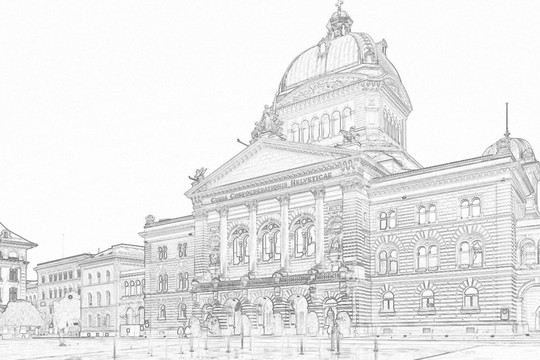

Kommentar