Hat das Radio eine Zukunft?

Der Begriff Radio ändert sich rasant. Lineares Hören verschwindet, Hörer*innen diktieren, was sie wo und wann hören wollen. Wie hängt das alles zusammen und werden wir in zehn Jahren noch Radio erleben? Dominik Born wagt als ehemaliger Leiter der Innovationszelle «SRF beta» und heutiger Berater und Coach für Innovationen im öffentlich-rechtlichen Umfeld einen Blick in die Zukunft.
Dass die Radio-Industrie im Wandel ist, kann einerseits daran gemessen werden, wie oft sie bereits totgesagt wurde. Andererseits zeigt sich der Wandel in der Vehemenz, in welcher manche Befürworter des Mediums Veränderungen belächeln oder verleumden. Egal, aus welcher Perspektive auf die Radioszene geschaut wird, die Umwälzung ist in vollem Gange. Auf die Frage, wie wir in Zukunft Radio hören, weiss aber niemand eine Antwort.
Wenig zielführend in der aktuellen Situation ist es, nur auf den Baukasten der technischen Möglichkeiten zu setzen: Ob es zukünftig DAB+ oder Radiostreaming sein wird, ob es Schauspieler sein werden, die uns mittels Audiosynthese die Nachrichten aus dem Kühlschrank vorlesen, oder ob es eingepflanzte Chips im Gehörgang sein werden – das alles hat zwar viel «Wow» aber wenig «How».
Um herauszufinden, wie und von welchen Anbietern wir in zehn Jahren Audioinhalte konsumieren werden, braucht es einen kleinen Ausflug in die Rundfunkgeschichte – fernab von Gadget-Shows und abgefahrenen Vorträgen mit Konfettieffekt.
Der Begriff Radio kommt laut Wikipedia aus dem lateinischen «Radius» für «Strahl». Was so viel heisst, dass auch die Inhalte, die zu Hause oder unterwegs aus den Geräten erschallen, in eben diesem Strahl «schwimmen». Und bekanntlich muss dieser Strahl fliessen, genau wie Wasser aus dem Hahn.
Als 1922 die ersten musikalischen Töne in der Schweiz über den Flughafenfunk vom Sender Lausanne durch Roland Pièce erschallten, wurde dieser Strahl zwar erstmals zweckentfremdet, doch seither hat sich daran nichts weiter geändert: Noch heute braucht es eine Audioquelle, die einen Ablauf abspielt. Das Signal wird verbreitet und bei einem anderen Ende wird das Signal empfangen und dem Ohr zugeführt.

Der Strahl, der dem Medium den Namen gab, bleibt unverändert. Die «Technologie» Radio kann einfach nicht mehr als das: linear ausstrahlen. Und so sind auch die Programmschaffenden dazu verurteilt, diesen Ablauf zu bestücken. Sie entscheiden, was jetzt und was später ausgeSTRAHLt wird. Und so manche Themen finden den Weg gar nicht erst auf den Sender. Die Entscheidung, was nun wichtiger ist, bedeutet Kompromiss. Dieser Kompromiss führt nicht nur zu internen Diskussionen, sondern auch zu Rückmeldungen unzufriedener Hörer*innen.
Traditionelles Radio fällt mit der klassisch-linearen Form in die «one size fits all»-Falle, die eigentlich noch nie allen immer nur gefallen hat. Und dennoch akzeptierte man mit der Zeit, auch auf der Empfängerseite, die technische Limitierung.

Mit dem Aufkommen des Internets Anfang der 1990er Jahre wurde die «On Demand / Auf Abruf»-Gesellschaft aus den technischen Fesseln befreit. Die Digitalisierung begann, die bestehenden Angebote an die Wand zu drücken. Die Aufmerksamkeitspanne der zu erreichenden Personen wurde mit jedem neuen Internetangebot kürzer und somit umkämpfter. Den Ursprung bildet zwar die Technik, diese wurde aber nur so schnell von der Gesellschaft umarmt, weil sie ein Grundbedürfnis der Selbstbestimmung deckte.
Auch Thales S. Teixeira, Autor von «Unlocking the Customer Value Chain», bezeichnet nicht die Technologie als den entscheidenden Veränderer, sondern die Konsument*innen selbst. Diese führen durch ihre Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten die Veränderung erst herbei – und schlussendlich zum Erfolg. Teixeira schreibt: «Viele der schnell wachsenden Start-ups wie Uber, Airbnb, Slack, Pinterest und Lyft haben keinen Zugang zu mehr oder besseren innovativen Technologien als die etablierten Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen. Was sie haben, ist die Fähigkeit, schneller und genauer zu bauen und zu liefern, was die Kunden wünschen.»

Um den Menschen das zu bieten, was sie möchten, sollte in einer globalen, vernetzten Welt auch global und vernetzt gedacht werden. Also Radio vom Internet her denken: Die komplette Wertschöpfungskette muss nicht mehr von jedem einzelnen Radioanbieter abgedeckt werden. Ein grösseres Medienhaus kann – im Gegensatz zu den globalen Plattformen – nicht alle bedienen. Dafür hat es weder den Auftrag noch die Fülle an Inhalten oder das Knowhow.
Als Beispiel dient an dieser Stelle der Detailhandel: Statt von einem Spezialisten zum anderen zu gehen, wählen beispielsweise die Kunden bei ihren Einkäufen bewusst den Generalisten. Dieser vereint viele Disziplinen unter einem Dach. Fachgeschäfte werden nur von jenen aufgesucht, die Zeit und Musse besitzen oder Idealismus stärker gewichten als Effizienz. Eine Chance für die Fachgeschäfte wäre also, um im Sinnbild zu bleiben, ein wertgenerierender Part bei den Grossisten zu werden. Auf fast jeder grossen Plattform (YouTube als Beispiel für Videoinhalte, Spotify für Audioinhalte) gibt es diejenigen, welche die Plattform wertvoll machen, und diejenigen, welche dafür bezahlen. Wer da mitverdienen möchte – sei es in Form von Geld oder auch Aufmerksamkeit, die heute als begehrte Währung gilt – sollte sich also entweder die Lücken suchen, die es auf diesen Plattformen gibt und diese dann mit seinen Inhalten füllen, oder er schafft für sein Inhaltangebot eine eigene kleine Plattform und versucht von dort aus, seine Klientel zu erreichen. Beziehungsweise, wenn es ums Radio geht: seine Hörer*innen.

Durch die Globalisierung der Inhalte entsteht dann aber die noch grössere Herausforderung: Um Inhalte zu hören, müssen immense Mediatheken durchsucht werden. Dieses Auswählen ist noch mühsam und frustriert viele Nutzer*innen. Laut diversen wissenschaftlichen Studien sind die Kunden bei einer reduzierten Auswahl zufriedener als bei einem Überangebot.
Doch welches sind die richtig gewählten Audioinhalte und für wen? Diese Problematik spielt den Radionostalgikern noch in die Karten: «Die Hörer*innen wollen nicht die ganze Zeit auswählen müssen, sondern überlassen uns die Auswahl sehr gerne» – Hier wird aber ein Problem zur Tugend erklärt und die Bevormundung als Service verkauft. Dabei könnte das Problem durch Design und geschickt programmierte Algorithmen vollständig gelöst werden. Dies bestätigt auch der sprunghafte Anstieg von Plattformen wie Spotify, Netflix oder YouTube. Ihr Angebot ist riesig und die personalisierten Vorschläge weiterer passender Inhalte funktionieren zwar noch nicht ganz perfekt, aber es lassen sich bereits ganze Abende füllen.

Einen weiteren Schritt für ein individualisiertes Audioangebot nahmen zwei «Grossisten»: Amazon und Google: Mit der Entwicklung der Smartspeaker Amazon Echo und Google Home entstand ein akustisches Interface, das durch reines Zurufen gesteuert wird. Nicht nur für Leute ein Segen, die noch nicht oder nicht mehr lesen können, sondern auch für Personen, die gerade die Hände nicht frei haben oder zwingend auf die Strasse schauen müssen. In jenen Ländern, in welchen die Smartspeaker und ihre Software offiziell im Handel erhältlich sind, werden bereits Veränderungen der Nutzung signifikant spürbar. Laut der «Smart Audio Studie» von NPR und Edison Research in den USA ersetzte der Smartspeaker bereits im Jahr 2017 bei 39 Prozent der Nutzer*innen das traditionelle Radio.

Um das Potenzial der Smartspeaker ausschöpfen zu können, muss auf die Grundbedürfnisse der Hörer*innen eingegangen werden: Diese möchten Inhalte ganz einfach mal überspringen, spannende Inhalte nach Thematik finden oder Empfehlungen für auf sie zugeschnittene Sendungen erhalten – auf Zuruf. Das Leben ist zu kurz für Inhalte, die uns nicht wirklich interessieren. Radioanbieter/-sender, die dies begreifen, werden auch in den nächsten zehn Jahren ihre Audioinhalte an die Leute bringen.

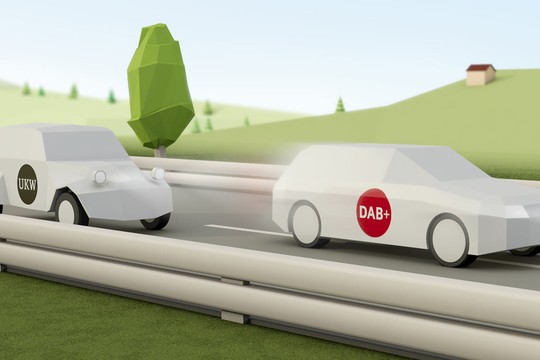

Kommentar