Rückhalt für den Journalismus

Aus der Politik kommen zunehmend Initiativen, die Medien zu stärken. Auch aus der Eidgenössischen Medienkommission.
Journalismus ist wichtig für die Demokratie. Journalismus ist auf Glaubwürdigkeit angewiesen. Journalismus braucht Support, wenn er seine Aufgabe auf hohem Niveau erfüllen soll. So weit, so bekannt.
«Der Journalismus braucht eine Rückenstärkung, weil er unter starkem Druck steht – aus ökonomischen Gründen, aber auch, weil das Bewusstsein für den Wert des Journalismus schwindet.»
EMEK
«Rückhalt für den Journalismus»
Neu ist die (medien-)politische Dimension. Auf dieser Ebene werden solche Aussagen wie oben akzentuiert – über die bekannten Hilferufe der Journalistinnen und Journalisten hinaus. Dazu zwei Beispiele – beide in der gleichen Woche Ende letzten Jahres publik gemacht: Die Konferenz der Kantonsregierungen rief zur Tagung nach Bern. Tenor: Die Entwicklung im Medienbereich schwäche notwendige Informationsleistungen, gefährde den Pluralismus und den Föderalismus. Deshalb sei das medienpolitische System herausgefordert. Der Kanton Waadt hat im Januar auch gehandelt. Er stellt für die Förderung von Medien und Medienkompetenz 6,2 Mio. Franken zur Verfügung. Beispiel zwei: Ein neues Papier der Eidgenössischen Medienkommission EMEK mit dem Titel «Rückhalt für den Journalismus». Eine Rückenstärkung brauche der Journalismus, weil er unter starkem Druck stehe – aus ökonomischen Gründen, aber auch, weil in Teilen der Bevölkerung das Bewusstsein für den Wert des Journalismus schwinde. Die EMEK führt weitere Krisensymptome auf: starke Konkurrenz durch partizipative Netzwerke und Vertriebsplattformen; Fehlleistungen des Journalismus; für die Nutzerinnen und Nutzer werde es zunehmend schwierig, parajournalistische von echten journalistischen Inhalten zu unterscheiden.
Die EMEK macht Vorschläge in fünf «Handlungsfeldern» – sie seien hier kurz genannt:
Die schwindende Finanzierbarkeit des Journalismus durch indirekte Medienförderung und finanzielle Anreize bekämpfen.
Mit Labels Erkenn- und Unterscheidbarkeit von journalistischen Inhalten verbessern.
Eine schärfere Trennung von interessengeleiteten (werblichen) und journalistischen Inhalten.
Das Berufsbild des Journalismus schärfen – zu prüfen sei eine Zertifizierung des Berufs.
Beim fünften Handlungsfeld geht es um das Verhältnis von Publikum und Medienhäusern respektive Akteuren der Publizistik. Die EMEK möchte das Bewusstsein für die Leistung des Journalismus für Demokratie und Gesellschaft stärken und dabei die Sicht der Nutzerinnen und Nutzer einbeziehen. Sie postuliert einen breit geführten öffentlichen Dialog über Journalismus, fordert Bildungsangebote im Medienbereich und setzt auf die kritische Reflexion über den Wert des Journalismus durch die Branche selbst.
Die Überlegungen der EMEK sind keine Neuerfindungen. Der Verleger der TX Group (Tamedia), Pietro Supino, spricht sich schon lange für eine Förderung der Medienkompetenz aus. Und die Trägerschaften der SRG können an dieser Schnittstelle zwischen Medienhaus und Publikum bereits Erfahrungen vorweisen. Dennoch stellt die EMEK fest, dass in der Schweiz eine breite Bürger*innen-Debatte über den Wert des Journalismus noch weitgehend fehle. Angesprochen sind deshalb die Medienhäuser und Redaktionen. Sie sollen beispielsweise Kodizes transparent machen, redaktionelle Entscheide erklären oder einen ernsthaften Publikumsdialog einrichten. Die EMEK wendet sich auch an Bildungsinstitutionen. Sie sollen Medienkompetenz und Wissen über Journalismus vermitteln, die Reflexion über Medien fördern – nicht nur bei der Schulbildung, sondern auch im Erwachsenenbereich. Konkret nennt die EMEK Bürger*innen-Foren, Tage der offenen Redaktion, Publikumsanlässe – generell also Foren für einen Dialog zwischen Journalismus und Publikum.
«Für die Nutzerinnen und Nutzer wird es zunehmend schwierig, parajournalistische von echten journalistischen Inhalten zu unterscheiden.»
EMEK
«Rückhalt für den Journalismus»
Und jetzt kommen Anstösse auch aus der Politik. Realisiert werden müssen sie zu einem Teil ausserhalb der politischen Strukturen. Die Frage bleibt dennoch, wie weit die Politik dabei fördern oder unterstützen kann. Zum Beispiel, indem Initiativen und Strukturen, die den Dialog zwischen Medien und Publikum vermitteln, (finanzielle) Unterstützung erhalten. Das macht unter anderen Deutschland vor mit den Aktivitäten der «Landeszentralen für politische Bildung» sowie über die klassischen Ausbildungseinrichtungen. Für die Schweiz könnte ein solcher Auftrag zur Förderung von Medienkompetenz und Mediendialog an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) delegiert oder in den Kantonen formuliert werden.
Einzelne Erfahrungen zeigen, dass auf Seiten Publikum das Interesse an diesem Mediendialog gross ist. Jetzt sind die Medienhäuser gefordert, für solche Foren engagierte und kompetente Dialogpartner zur Verfügung zu stellen.


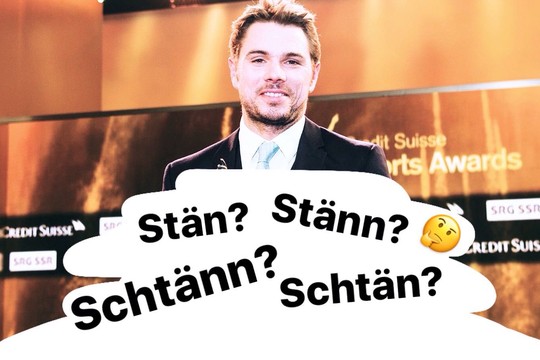
Kommentar