«Musik ist wie eine Sprache»

Prof. Dr. Lutz Jäncke, Neuropsychologe an der Universität Zürich, befasst sich in seiner Forschung unter anderem mit dem Gehirn und Musik. Wir haben mit ihm über The Doors, Helene Fischer und Wagner sowie über Ohrwürmer und Gänsehautmusik gesprochen.
Lutz Jäncke, nahezu alle Menschen mögen Musik. Wieso?
Weil mittels Musik sehr viele Emotionen transportiert und ausgelöst werden. Auch ist der Zugang relativ einfach, man muss nur lauschen. Und: Es handelt sich um ein Grundelement der nonverbalen Kommunikation. Neandertaler haben schon sehr früh begonnen, Flöten zu basteln. Wahrscheinlich haben sie mit ihren Gruppenmitgliedern am Lagerfeuer gesessen und den Melodien gelauscht. Vielleicht haben sie auch dazu gesungen, vielleicht tanzten sie. Musik hat die Fähigkeit, Menschen zu synchronisieren. Eine Gruppe, die gemeinsam Musik hört, begibt sich langsam in die gleichen Emotionen und beginnt, sich ähnlich im Takt der Musik zu bewegen. Diese emotionale und körperliche Synchronisation ist von herausragender Bedeutung für den Menschen, denn es fördert das Gruppengefühl und den Zusammenhalt. Ein anschauliches Beispiel – das kann ich als ursprünglicher Düsseldorfer bestätigen – ist der rheinische Karneval: Da sitzen Leute in Gaststätten, hören seltsame Musik – und beginnen plötzlich zu schunkeln.
Was macht Musik mit unserem Gehirn?
Die akustischen Reize gelangen als Luftschwingungen zu unseren Ohren. Von dort werden sie zum Hörkortex geleitet, der die Töne zu Melodien zusammensetzt. Wenn diese Melodien ein gewisses vorhersehbares Muster aufweisen, gefällt uns das. Dann schüttet unser Lustzentrum den Transmitter Dopamin aus, der eine Kaskade von neurophysiologischen Reaktionen auslöst, die letztlich zu angenehmen Gefühlen, ja sogar Glücksgefühlen führen. Ein Teil der Aktivierungskaskade beeinflusst das vegetative Nervensystem – die Herzrate, die Atmung etc. verändern sich. Das geht so weit, dass sich beim Musikhören Gänsehaut entwickeln kann. Zum Beispiel beim Song «We are the Champions» von Queen. Man muss allerdings bedenken, dass die Reaktionen auf Musik durchaus individuell sein können und von unserer Erfahrung sowie unserer Interpretation abhängen. Auch die Häufigkeit des Hörens des jeweiligen Musikstücks spielt eine Rolle. In Tibet hören Mönche vor allem Obertongesang – für uns ist das nicht besonders attraktiv, weil wir das nicht gewohnt sind.
Ich habe als Teenager Hardrock und Metal gehört und verabscheute Hiphop. Meine Eltern haben aber weder Hardrock noch Hiphop gehört.
Das war bei mir ähnlich. Meine Eltern hörten Rock’n’Roll, für mich war das furchtbar. Sie fanden dafür die Rolling Stones und The Doors grauenhaft. Man nennt das auch Peer-Group-Abgrenzung: Man will sich von anderen sozialen Gruppen oder Generationen unterscheiden. Dazu habe ich eine lustige Anekdote: Wir haben zu einer Studie Hiphop-Fans eingeladen, die ihre Lieblingsmusik mitbringen sollten. Wir erwarteten, dass beim Hören ihrer Lieblingsmusik das Lustzentrum besonders stark aktiv sein würde. Mit Erstaunen haben wir aber festgestellt, dass bei zwei Drittel der Probanden überwiegend Gehirnteile aktiviert waren, die mit negativen und unangenehmen Empfindungen verbunden sind. Danach haben wir diesen Personen Hits von Robbie Williams vorgespielt, die sie nicht besonders mochten. Obwohl sie diese Musik ablehnten, feuerte bei vielen das Lustzentrum. Das zeigt: Die subjektive Bewertung der Musik stimmt nicht unbedingt mit den neurophysiologischen Reaktionen im Gehirn überein. Man kann dies auch bei einigen Klassikfans feststellen, die beim Hören von Volksmusik Aktivierungen im Lustzentrum zeigen, während dies beim Hören von klassischer Musik nicht geschieht.
Spielt es für das Gehirn eine Rolle, ob wir Rockmusik, Hiphop oder Klassik hören?
Ja. Laute und schnelle Musik erzeugt andere Aktivierungsmuster als langsame, leise Musik. Intensivere Musik benötigt mehr Prozessierung im Gehirn. Auch hängt es von verschiedenen Faktoren ab, welche Bereiche im Gehirn aktiviert werden: Tanzmusik oder rhythmische Musik führen zu einer stärkeren Aktivierung in den motorischen Hirnarealen. Musik, die persönliche Erinnerungen weckt, etwa an die Jugend oder andere Erlebnisse, führt dazu, dass die Gedächtniszentren im Temporallappen besonders stark aktiv sind; eben weil Erinnerungen abgerufen werden.
Das Gehirn wird also je nach Musikstil anders beansprucht.
Genau. Es hängt auch damit zusammen, wie wir Musik hören. Zum Beispiel das diffuse Hören, wenn jemand auf der Strasse mit Kopfhörern nebenbei Musik hört. Beim sentimentalen Musikhören versuche ich, mich in eine gewisse Gefühlslage zu versetzen. Ich mache das oft, indem ich die gleiche Musik wie als 20-Jähriger höre, etwa The Doors. Oder das analytische Hören: Wenn ich mir Wagner anhöre, versuche ich Analysen durchzuführen. Ich überlege, welche Motive er verwendet hat. Man kann auch emotional korrigierend oder modulierend hören – wenn ich nachts Auto fahre, dann höre ich absichtlich Musik, die erregt, damit ich nicht einschlafe. Was ich damit zum Ausdruck bringen will: Jeder Mensch, auch der grösste Klassikfan, hört unterschiedliche Musik zu unterschiedlichen Zeitpunkten und zu unterschiedlichen Zwecken. Ich bin ein grosser Klassikfan, höre aber nie während des Autofahrens Wagner – sonst würde ich gegen eine Mauer fahren. Auch käme mir nicht in den Sinn, zum Feiern an Sylvester eine Beethoven-Platte aufzulegen. Das passt nicht.
Wieso präferieren wir bestimmte Genres und bestimmte Musikstücke?
Wir hören gern das, was wir häufig hören. Das sieht man schon bei Babys. Es hat aber auch mit intellektuellen Voraussetzungen zu tun. Wer noch nie Klassik gehört hat, wird wohl seine Probleme mit diesem Musikstil haben. Der Vor- und Nachteil vieler klassischer Musikstücke ist, dass sie komplex sind. Deshalb kann man Jahrzehnte lang das gleiche Stück hören und hört immer etwas Neues. Dies erfordert ein gewisses Mass an Aufwand, um sich damit auseinanderzusetzen. Schlager hingegen ist simpel und fürs Gehirn einfach zu verdauen. Und das meine ich nicht despektierlich – auch ich höre Schlager in bestimmten Situationen. Wenn diese Musik dazu beiträgt, unsere Lustempfindung zu aktivieren, dann finde ich das super.
Können sich solche Vorlieben im Laufe des Lebens ändern?
Ja, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich kam erst in den 1990er-Jahren durch meine ersten Studien im Bereich Neurologie und Musik mit der Klassik in Kontakt und habe viel über diesen Musikstil gelernt – so habe ich immer mehr Interesse entwickelt, und mein Geschmack hat sich massiv verändert. Diese Erfahrung hat mir die Augen beziehungsweise die Ohren geöffnet. Ein anderes Beispiel: Die Filmmusik zu einem neuen James-Bond-Film kommt immer vor der Filmpremiere auf den Markt. Wir haben beim Musikstück von Sam Smith bei den Probanden die Hirnaktivität vor und nach dem Erscheinen des Films gemessen. Zunächst wurde die Musik von den Fans sehr kritisch beurteilt, da die Stimme des Sängers sehr hoch ist, Bond aber den Macho-Typ verkörpert. Nach dem Film haben wir das Experiment erneut durchgeführt: Nun fanden 90 Prozent derjenigen, die die Musik erst schlecht gefunden hatten, das Lied toll. Das zeigt: Die Erfahrung kann solche Wahrnehmungen beeinflussen.
Braucht es für Deutsche Schlager und für Schweizerinnen und Schweizer Jodelmusik, um ein Heimatgefühl zu provozieren?
Unsere Persönlichkeit ist unser Gedächtnis – unsere Erfahrung und unsere Erinnerung machen uns aus. Vor allem die Musik aus unserer Kindheit ist fest in unserem autobiografischen Gedächtnis verankert. Bei an Demenz erkrankten Personen aktiviert die Musik aus der Kindheit Emotionen und Erinnerungen. Es kann sein, dass das in der Schweiz das Alphorn oder das Jodeln ist. Ich bin früher immer vor dem Karneval geflohen. Jahre später bei meiner Arbeit im Ausland habe ich mich aber dabei ertappt, zur Karnevalszeit im Radio nach dieser Musik zu suchen. Das ist genau der Punkt: Wenn man sentimentale Empfindungen sucht, hilft Musik.
Warum haben wir eigentlich Ohrwürmer?
Musik wird in unserem Gedächtnis gespeichert, und zwar in Form einer Hierarchie. Sehr weit oben befinden sich oft leicht abrufbare Stücke, sprich mit vorhersehbaren Melodien. Diese drängen sich unserem Gedächtnis sehr schnell auf. Das kann teilweise sehr heftig sein. Es gibt pathologische Fälle, bei denen taub gewordene Menschen das Gefühl haben, sie hören Musik. Das können unterschiedliche Melodien sein, oder auch nur ein Instrument oder Gesang. Dieses Phänomen nennt man Musikhalluzination. Ein tauber Patient, den ich untersucht hatte, hörte ununterbrochen «That’s the way I like it». Das Bemerkenswerte ist: Wenn wir bei diesen Tauben die Hirnaktivität messen, stellen wir fest, dass die sekundären Gehörareale beim imaginativen Hören aktiv sind. Das heisst, auch wenn es keine externen Signale gibt, kann der Hörkortex aktiv sein.
Was hilft, um einen Ohrwurm wieder loszuwerden?
Die kann man nur schwer löschen. Am besten hört man andere Musik und füttert das Gedächtnisnetzwerk mit neuer Musik, damit sich die Gedächtnishierarchie verändert und der Ohrwurm in der Hierarchie absteigt.
Verglichen mit den anderen Sinnen, wie wichtig ist das auditorische Gedächtnis?
Der Mensch ist ein Sehtier: Wir sind schlechte Riecher, Hörer und Schmecker, denn ein grosser Teil des Gedächtnisses ist auf das Sehen ausgerichtet. Musik ist aber etwas sehr Menschentypisches. Zwar gibt es Studien, die behaupten, Kühe würden mehr Milch geben, wenn sie Mozart hörten, aber das ist Quatsch. Die können die Musik nicht unterscheiden, die merken höchstens, dass der Melker, der Mozart hört, anders melkt. Es braucht ein hohes Mass an Intelligenz, um Musik zu erfinden, zu machen und zu verstehen. Begonnen beim Bau von Instrumenten über das Üben der Geschicklichkeit, dem Komponieren von Melodien – das macht kein Schimpanse. Darum hängen wir so stark an der Musik. Sie ist wie eine Sprache.
Mehr zu Lutz Jäncke
Mehr zu Lutz Jäncke
Lutz Jäncke, geb. 1957 in Wuppertal, DE, ist Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich. Schwerpunkte seiner Forschung sind die kognitive Psychologie und die Plastizität des Gehirns. Jäncke gehört zu den am häufigsten zitierten Wissenschaftlern weltweit. Von den Studierenden wurde er mehrfach für seine Art der Wissensvermittlung ausgezeichnet. Lutz Jäncke ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne und lebt in Zürich.

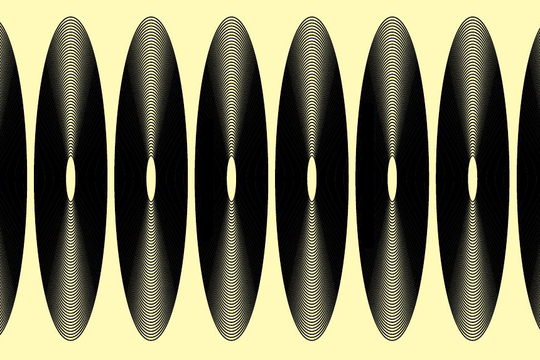

Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.