Versteckte Kamera bei Homosexuellen-«Heilung» war zulässig

Ein junger SRF-Reporter begab sich für das Online-Format «rec.» undercover zu christlichen Seelsorgern und Seelsorgerinnen, welche Konversionstherapien anbieten. Die «Rundschau» vom 26. Januar 2022 nimmt die Reportage in einem Beitrag und einem Thekengespräch auf. Dazu sind acht Beanstandungen eingegangen. Vor allem der Einsatz der versteckten Kamera wird kritisiert und als unfair und nicht rechtens empfunden. Die Ombudsleute stellen sich hinter das Vorgehen der Redaktion.
Gewisse freikirchliche Therapeuten bieten Konversionstherapien an, um die geschlechtliche Identität von LGBTQ+- Menschen zu ändern. Ein Reporter des Online-Formats «rec.» nimmt als fiktive Figur «Guido» undercover an solchen Sitzungen teil und spricht im Verlauf der Sendung mit einem Betroffenen und mit einem Religionswissenschaftler. Zusätzlich diskutiert die «Rundschau» in einem Thekengespräch mit dem Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz über ein Verbot von Konversionstherapien in der Schweiz.
Acht Beanstanderinnen und Beanstander kritisieren das Vorgehen von SRF als unehrlich und unfair. Sie stossen sich am Einsatz der versteckten Kamera und stellen dessen Rechtmässigkeit in Frage. Sie sehen auch die Privatsphäre der Seelsorgerinnen und Seelsorger verletzt. Manche kritisieren den Beitrag als einseitig und schwarz-weiss. Sie wünschen sich mehr Sorgfalt und Respekt im Umgang mit christlicher Thematik. Andere appellieren an die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die sexuelle Orientierung werde im Beitrag über die Religion gesetzt.
Breite gesellschaftliche Debatte
Die versteckte Kamera ist eine der stärksten journalistischen Recherche-Methoden, schreibt die verantwortliche SRF-Redaktion in ihrer Stellungnahme. Ihr Einsatz müsse immer sorgfältig abgewogen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat deren Einsatz unter bestimmten Voraussetzungen gutgeheissen. Zum Beispiel müsse ein überwiegend öffentliches Interesse an der Aufdeckung einer Tatsache gegeben sein.
In den letzten Jahren habe sich die Debatte um Konversionstherapien im In- und Ausland verstärkt, schreibt die «rec.»-Redaktion in ihrer Stellungnahme. Frankreich, Kanada, Deutschland und Österreich hätten bereits ein Verbot für Konversionstherapien bei Minderjährigen erlassen. In der Schweiz lehnt der Bundesrat solche Praktiken aus «menschlicher, fachlicher und rechtlicher Sicht» ab. Zwei parlamentarische Initiativen für ein Verbot auf Bundesebene und mehrere auf Kantonsebene sind hängig. Das überwiegende öffentliche Interesse sei bei den beanstandeten Beiträgen gegeben, ist SRF überzeugt. Die Reportage liefere zum ersten Mal in der Schweiz den Bewegtbild-Beweis, dass hierzulande Konversionstherapien durchgeführt würden. Die Aufnahmen wären ohne verdeckte Recherchen nicht möglich gewesen, da solche Therapien nicht offen beworben und angeboten würden. Vielmehr bestritten mehrere christliche Organisationen, sie im Angebot zu haben.
Die gefilmten Personen seien im Beitrag anonymisiert und deren Privatsphäre somit gewahrt worden. Es sei im Beitrag nicht darum gegangen, Kritik an einzelnen Personen auszuüben, sondern die Thematik der Konversionstherapien aufzuzeigen, so die Redaktion.
Gefahr für die psychische Gesundheit
Konversionstherapien bauten auf der Vorstellung auf, Homosexualität sei eine Krankheit. Diese Prämisse sei klar überholt, schreibt die Redaktion. Es herrsche heute ein wissenschaftlicher Konsens, dass solche Therapien schädlich seien. Ärzteverbände, die Weltgesundheitsorganisation WHO und die UNO lehnten sie ebenfalls ab.
Das Vielfaltgebot sieht die Redaktion nicht verletzt. SRF belegt, dass es breit und aus verschiedenen Perspektiven über religiöse Themen berichtet. Auch das Spannungsfeld «Glaube an Gott» und «sexuelle Orientierung» werde immer wieder thematisiert.
Kommentare als solche erkennbar
Bei der Beurteilung ist gemäss den Ombudsleuten die gewählte journalistische Form von Belang. «rec.» ist ein neues Reportageformat und richtet sich an ein jüngeres Zielpublikum. Sprache und Machart entsprechen den Sehgewohnheiten eines jüngeren Publikums. In einer Reportage würden Fakten mit subjektiven Eindrücken ergänzt, so die Ombudsleute. Die Reaktionen des Reporters nach den «Therapie»-Sitzungen seien Teil des Formats und würden transparent als subjektive Wahrnehmung und damit als Kommentar gezeigt. Die Reportage sei korrekt, faktenbasiert, sorgfältig gemacht und erfülle die gesetzlichen Vorgaben.
Den Einsatz der versteckten Kamera beurteilen die Ombudsleute ebenfalls als gerechtfertigt. Es bestehe ein öffentliches Interesse an der Thematik. Massgebend dafür ist in den Augen der Ombudsleute die allgemeine gesellschaftliche Sensibilität für Genderfragen und die beiden im letzten Herbst eingereichten parlamentarischen Initiativen. Die Ombudsleute unterstützen die Beanstandungen nicht.
Die beanstandenten Beiträge im Video
Die beanstandenten Beiträge im Video
«Rundschau» vom 26. Januar 2022
- Beitrag: «Im Namen Jesu»: Homosexualität betend wegtherapieren (ab Timecode 0:40)
- Thekengespräch mit Marc Jost, Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz (ab Timecode 14:10)
«rec.»
- «rec.» vom 25. Januar 2022: «Plötzlich hetero? – Schweizer Seelsorger:innen wollen Betroffene umpolen»
- Q&A zur Reportage vom 1. Februar 2022

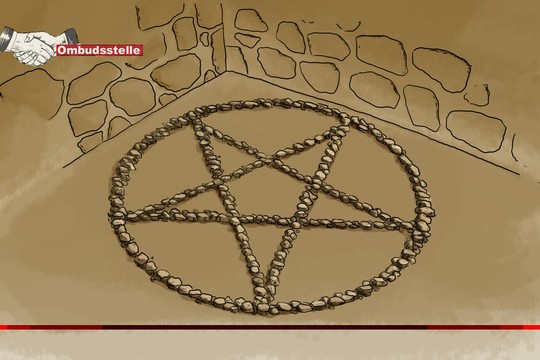

Kommentar