Medien ohne Barrieren: «Es braucht noch viel Aufklärung»

Zur Person:
Nathalie Anderegg erhielt vor 24 Jahren die Diagnose schizo-affektive Störung, das ist eine Form von Schizophrenie. Sie lebt seither mit einer IV-Rente. Heute ist sie Journalistin beim Verein Reporter:innen ohne Barrieren. Sie setzt sich so für inklusive Medienarbeit und verbesserte Repräsentation von Menschen mit Behinderungen in den Medien ein.
Nathalie Anderegg ist Journalistin und Teil des Vereins Reporter:innen ohne Barrieren. Sie macht sich stark für einen besseren Zugang zu Medien für Menschen mit Behinderungen – aber auch für inklusive Perspektiven in gesellschaftlichen Debatten.
Nathalie Anderegg, wann sind Sie als Journalistin das letzte Mal an eine Barriere gestossen?
Durch meine psychische Behinderung sind laute und stark frequentierte Orte und Plätze für mich eine Überforderung. Zum Beispiel bedeuten volle Züge für mich Stress. Aussentermine wahrzunehmen und dafür an andere Orte zu reisen ist für mich deshalb schwierig.
Wie gehen Sie damit um?
Zum einen versuche ich Gespräche, Interviews und Sitzungen von zuhause aus zu absolvieren. Dank dem technologischen Fortschritt haben sich die Webcalls in den letzten Jahren zu einer tollen Alternative entwickelt. Wenn ich aber doch reisen muss, kaufe ich mir ein 1.-Klasse-Ticket, wenn der Zug zu voll ist. Das entspannt die Situation für mich schon enorm.
Man sieht Ihnen Ihre Behinderung nicht an. Im Newsletter der SRF-Stiftung «Denk an Mich» schreiben Sie, deswegen seien nicht alle Barrieren offensichtlich. Was meinen Sie damit?
Nebst dem vorhin genannten Beispiel ist vor allem die Stigmatisierung eine grosse Hürde. Als Person mit Schizophrenie hat meine Meinung in der öffentlichen Wahrnehmung weniger Gewicht. Man glaubt, schizophrene Menschen könnten aufgrund ihrer Erkrankung keine sachlichen Beiträge zu gesellschaftlichen Diskussionen liefern, man setzt alles in Zusammenhang mit der Krankheit. Dem möchte ich durch meine Medienarbeit entgegenwirken und ein realistischeres Bild der Krankheit bekannt machen.
Wir sprechen heute offener über psychische Gesundheit. Ist das für Sie spürbar?
Gerade in den Medien hat sich viel getan. Es ist viel mehr Offenheit und Verständnis für Behinderungen aller Art da. Robin Rehmann hat mit seinen Interviews mit Betroffener aller Arten von Behinderungen («Sick of Silence», A. d. R.) sehr wichtige Pionierarbeit geleistet. Aber es braucht noch immer viel Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft. Dort bleiben alte Stigmata und Vorurteile bestehen.
Was wären konkrete Massnahmen, die mehr Barrierefreiheit in der Schweizer Medienlandschaft schaffen würden?
Die Digitalisierung und KI bieten wunderbare Chancen für mehr Untertitel und Audiodeskription. Aber eine grosse Barriere, die viele von uns betrifft, ist nicht einmal physischer Natur. Für viele geht es ganz einfach ums Geld.
«Eine grosse Barriere ist ganz einfach das Geld.»
Menschen mit Behinderungen erhalten oft eine IV-Rente mit Ergänzungsleistungen. Der Zugang zu den Medien ist heute oft hinter Paywalls verborgen, Artikel lesen können nur Abonnent:innen. Das macht es für viele von uns schwierig, sich zu informieren.
Aber Journalismus kostet – da gibt es einen Interessenskonflikt.
Früher konnte man einzelne Artikel kaufen, heute muss man immer gleich ein Abonnement lösen. Das können sich viele nicht leisten. Und kann problematisch werden, etwa wenn auf den Sozialen Medien Artikel mit einer zugespitzten Headline beworben werden. Das bringt vielleicht Klicks, doch bleibt die vertiefte Einordnung dem Publikum ohne Abo vorenthalten. Was zurückbleibt, ist die Headline. Hier bräuchte es eine Lösung. Denkbar wären etwa Voucher für Menschen mit Ergänzungsleistungen, damit sie einzelne Artikel freischalten könnten.
Reporter:innen ohne Barrieren ist erst im Aufbau. Wo steht der Verein aktuell?
Wir sind daran, uns aufzustellen. Wir machen uns bekannt, lernen voneinander. Menschen mit Behinderungen befanden sich bis jetzt in ihrem behinderungs-spezifischen Umfeld, es gab kaum Austausch. Das wollen wir ändern, wir wollen uns untereinander vernetzen. So möchten wir den Kontakt zwischen Menschen mit verschiedenen Behinderungsarten, sowie auch den Kontakt der Gesellschaft mit Menschen mit Behinderungen intensivieren, so dass Barrierefreiheit im Alltag für alle selbstverständlich wird.
«Wer mitten in der Gesellschaft steht, sieht oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wir stehen am Rand und sehen so die Bäume und den Wald.»
Immerhin leben in der Schweiz 1,8 Millionen Personen mit Behinderungen. Wir sind zu viele, als dass man uns weiterhin ignorieren könnte. Alle Themen der Gesellschaft betreffen auch uns Menschen mit Behinderungen, und so werden wir künftig unüberhörbar überall mitmischen. In diesem Sinne werden wir von RoB zum Inklusions-Motor.
Was wird Reporter:innen ohne Barrieren konkret tun, um die Inklusion in den Medien zu stärken?
Wir sind ein Team aus Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen. Wir agieren wie eine Agentur, man kann uns buchen. Wir werden aber auch selbst Themen einbringen und Perspektiven aufzeigen. Wer mitten in der Gesellschaft steht, sieht oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wir stehen am Rand und sehen so die Bäume und den Wald. So haben wir einen ganz anderen Blick. Diesen bringen wir in Diskussionen und Debatten ein, und davon kann die ganze Gesellschaft profitieren. Zudem werden wir in Zukunft mit Leitfäden und Workshops Sensibilisierungsarbeit in den Medien und anderen Akteuren der öffentlichen Kommunikation leisten.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass viele oder sogar alle gesellschaftlichen Barrieren bald verschwinden?
Ich bin zuversichtlich. Es hat sich ja bereits viel getan. Das zeigt sich exemplarisch an der Kommunikation mit Betroffenen in der Psychiatrie: Ich habe noch Zeiten erlebt, in denen Betroffenen nicht zugehört wurde. Man musste einfach die Anweisungen der Psychiater:innen befolgen. Dies ist heute ganz anders, die Mitbestimmung bei der eigenen Behandlung ist viel grösser. Und die Psychiatrien sind offen für Inputs der Betroffenen.
Als Beispiel: Für einen Podcast, der für Winter oder Frühling 2025 geplant ist, konnte ich richtige Koryphäen der schweizerischen Psychiatrie gewinnen. Dass sie bei einem solchen Format für Reporter:innen ohne Barrieren mitmachen, zeigt für mich den Wandel in der Fachwelt gut auf. Es scheint mir sogar so zu sein, dass die Fachleute so bereitwillig bei dem Podcast mitmachen, gerade weil ich selbst betroffen bin. Als Betroffene werde ich das Thema aus einer neuen, anderen Perspektive angehen, und dies wird auch für die Fachwelt interessant sein. Deshalb sehe ich hoffnungsvoll einer spannenden Zeit entgegen.
Zum Verein
Der Verein Reporter:innen ohne Barrieren setzt sich für mehr Inklusion in den Schweizer Medien ein. Dafür werden Menschen mit Behinderungen zu Reporter:innen geschult. Ziel ist, die Perspektive von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit verstärkt einzubringen sowie Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. Der Verein wird unterstütz durch die SRF-Stiftung Denk an mich.
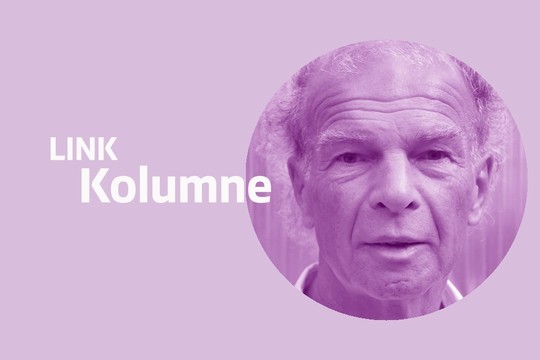


Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.