Regula Hänggli Fricker: «Es gilt, Gemeinschaft zu schaffen»

Für Politprofessorin Regula Hänggli Fricker muss der Service public das Publikum nicht nur informieren, sondern auch für Zusammenhalt und Gemeinschaft sorgen. Im Interview spricht sie über die Entwicklung des Publikums im digitalen Zeitalter, über Dialog und Macht.
Zur Person
Zur Person
Prof. Dr. Regula Hänggli Fricker ist Professorin für politische Kommunikation an der Universität Freiburg. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit (digitaler) Demokratie, öffentlichen Debatten, Meinungsbildung sowie der Bedeutung des Strukturwandels der Medien für deren staats- und demokratiepolitische Funktionen. 2020 erschien ihr Buch «The Origin of Dialogue in the News Media» (Der Ursprung des Dialogs in den Nachrichtenmedien). Zudem war sie Mitglied einer temporären Expertengruppe des Bundes, die sich mit der digitalen Transformation der Gesellschaft befasste.
Regula Hänggli Fricker, früher gab es eine Art imaginärer Zuschauer, den sich Programmmachende vor Augen hielten, heute gilt das Publikum als viel heterogener. Was heisst das für die Medien?
Ich würde nach wie vor am Begriff Publikum festhalten. Dies jedoch ohne sich den imaginären Zuschauer vorzustellen, sondern viel eher mit dem Gedanken einer imaginären Gemeinschaft. Ich habe da das Publikum der öffentlichen Diskussion, beispielsweise über das nächste Abstimmungsthema, vor Augen. Was macht uns zu Schweizerinnen und Schweizern, was macht uns zur Gemeinschaft? Die Institutionen. Institutionen wie die direkte Demokratie halten uns zusammen, auch über verschiedene Identitäten hinweg. Diese Gemeinschaft muss nicht immer politisch institutionalisiert stattfinden, sie wird auch spürbar während einer Fussball-WM oder durch eine TV-Serie wie «Tschugger». Wenn es gelingt, dass viele vom Gleichen sprechen, kommt es zu diesem Gemeinschaftsgefühl. Das ist das Publikum.
Gleichzeitig gibt es immer mehr Angebote, sei es in den Nachrichten, im Sport oder in der Unterhaltung. Das Publikum ist viel stärker fragmentiert. Muss man als SRG den Begriff «Publikum» hinterfragen?
Nein. Natürlich wird der Fokus durch die Digitalisierung diverser und globaler, eine Gemeinschaft ist längst nicht mehr nur national. Dennoch ist die Schweiz eine Willensnation, und daran wollen wir festhalten. Es gilt also, die Gemeinschaft zu schaffen. Gerade der Service public hat ja den Anspruch, die Schweiz zu informieren, sie zusammenzuhalten. Nimmt man die Schweiz als politische Einheit, sollte man somit weiterhin von Publikum sprechen.
Ist dies in einem Land mit verschiedenen Sprachregionen überhaupt möglich?
Ja. Bei den Abstimmungen zeigt sich, dass in der ganzen Schweiz – mit wenigen Nuancen – die gleichen Argumente verwendet werden. Grundsätzlich transzendiert das. Die Berichterstattung über andere Sprachregionen spielt ebenfalls eine grosse Rolle: Wenn in Genf etwas stattfindet, was eine Wichtigkeit hat, dann wird darüber auch in der Deutschschweiz berichtet – und umgekehrt. Diese Dynamik braucht es, um Hürden abzubauen und Vielfalt zu fördern. Die Institutionen halten uns somit selbst über die Sprachgrenzen hinweg zusammen.
Das Publikum ist auch deshalb relevant, weil es die Wahl der Themen oder die Berichterstattung beeinflussen kann. Wie stark sollten sich Medien an den Interessen des Publikums orientieren?
Man sollte bei der politischen Information nicht abhängig sein von den Konsumentinnen und Konsumenten respektive den Klicks. Die Medien sollten unabhängig darüber berichten, was für uns als Gesellschaft relevant ist – insbesondere bei einem öffentlichen Sender. Bei den Privatmedien, die finanziell unter Druck stehen, herrscht aber oft eine ökonomische Logik: Etwas hat Wert, wenn es konsumiert wird. Auf ihren Tools sehen die Medienschaffenden, welche Anzahl Klicks sie für welche Beiträge erhalten. Dieser Druck, für das eigene Publikum zu schreiben, hat stark zugenommen. Durch schrumpfende Budgets und schrumpfende Teams ist es aber auch schwieriger geworden, Alltagsgeschichten zu machen – die Redaktion erwartet grosse, aussergewöhnliche Geschichten. Das betrifft unter anderem auch Freischaffende. Somit ist in Privatmedien eine deutlichere Orientierung an den – vermeintlichen! – Publikumsinteressen feststellbar.
Was bedeutet das für den Service public, der ein breites Publikum bedienen muss?
Bei den öffentlich finanzierten Medien sollte es darum gehen, was einen Wert für die Allgemeinheit hat. Gerade die SRG muss einen öffentlichen Auftrag erfüllen. Sie hat einen Meinungsbildungsauftrag, und sie soll auch für ein Nischenpublikum Angebote offerieren.
«Man muss auch im Lokaljournalismus Lösungen finden, damit nicht nur skandalträchtige Storys publiziert werden.»
Es lässt sich allerdings eine gewisse Abwendung von sogenannten Mainstream-Medien feststellen, die Rezeptionsräume werden kleiner. Was heisst das für den gesellschaftlichen Dialog?
Ich finde, das muss man relativieren. Es sind verhältnismässig wenige, die sich komplett abkoppeln. Dennoch muss man dafür sorgen, dass sie und der Rest der Bevölkerung nicht abgehängt werden. Auf nationaler Ebene funktioniert dies im Grossen und Ganzen nach wie vor, das sieht man bei Abstimmungen. Was im Parlament besprochen wird, wird von den Parteien weitergetragen, es gibt Abstimmungskämpfe. Der Dialog zwischen den verschiedenen Seiten besteht also immer noch. Wo es allerdings problematisch wird, ist im Lokaljournalismus. Es gibt Hinweise, dass Alltagsgeschäfte weniger Resonanz haben, weil sie etwas «langweiliger» sind. Auch die Chronistenaufgabe wird vernachlässigt. Viele wohnen nicht am selben Ort, wo sie arbeiten. Hier stellt sich die Frage, wie der Zusammenhalt und die Verwurzelung stattfinden können. Dem muss man Sorge tragen und auch im Lokaljournalismus Lösungen finden, damit nicht nur skandalträchtige Storys publiziert werden, sondern es eine gewisse Verlässlichkeit und Kontinuität in der Berichterstattung gibt.
Traditionelle Informationssendungen werden weniger beachtet als früher, die Menschen sind auf zahlreichen Plattformen unterwegs. Ist es an den Medien, ihr Publikum zu suchen?
Das wird bereits gemacht. Die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind vorhanden, und ich bin zuversichtlich, dass da auch neue Möglichkeiten ausprobiert und genutzt werden. Was Medien noch mehr leisten können, ist eine kritische Beobachtung der Wirtschaft. Es braucht eine öffentliche Debatte über den globalen Handel, die Finanzmärkte und den Zusammenhang mit der Gesellschaft, unter Teilnahme auch der Exponentinnen und Exponenten der Wirtschaft. Dient die globale Wirtschaft der Gesellschaft oder ausschliesslich dem Shareholder? Da gibt es Fragezeichen. Auch braucht es eine öffentliche Debatte über soziale Medien. Entsprechen diese intermediären Kanäle unseren Werten und Vorstellungen oder nur den wirtschaftlichen Interessen der dahinterstehenden Unternehmen? Warum haben wir soziale Medien, die den Jugendlichen nicht guttun? Warum sind wir digital nicht anders unterwegs? Es gibt ein grosses politisches Potenzial, und meiner Meinung nach wäre es die Aufgabe des Service public, diese Debatten zu lancieren.
Der Dialog mit dem Publikum ist in den letzten Jahrzehnten markant gewachsen, unter anderem wegen Social Media. Ist das Fluch oder Segen für die Medien?
Es geht um die Frage: Welche Meinungen sind am Schluss wichtig? Wird lediglich die Emotionalität bewirtschaftet, hat das für uns als Gesellschaft keinen Nutzen. Das Wutbürgertum zu fördern, ist sicher nicht der richtige Weg. Dennoch finde ich die Kommentarmöglichkeit per se nicht schlecht. Vielleicht müsste man dies aber anders gestalten. Zum Beispiel, indem Kommentare nach zwei Minuten wieder verschwinden, sodass man sich Luft machen kann, dies aber nicht für alle sichtbar bleibt. Oder dass nur konstruktive Kommentare online bleiben. Eine andere Option wäre, das Publikum positives Feedback schriftlich verfassen zu lassen und negatives Feedback mündlich. Es gäbe viele Möglichkeiten. Man muss es ausprobieren. Der Dialog mit dem Publikum soll ja auch Spass machen oder konstruktiv sein.
Gleichzeitig hat die Digitalisierung dazu geführt, dass das Machtgefälle zwischen Medien und Publikum kleiner geworden ist.
Natürlich wäre es ideal, wenn die Digitalisierung es ermöglichen würde, dass alle gehört werden. Doch leider ist dem nicht so. Eine Studie über Facebook etwa zeigt, dass nur ganz wenige Nachrichten wirklich verbreitet werden. Die Algorithmen bestimmen, was Aufmerksamkeit erzeugt. Dies ist jedoch nicht repräsentativ und verzerrt die Wahrnehmung, die Algorithmen bilden unsere Realität nicht ab. Es gibt eine Verschiebung zugunsten von Nachrichten, die Aufmerksamkeit generieren und damit der Ökonomie dienen, sprich der Werbewirtschaft. Das entspricht nicht unserer Konsensdemokratie. Auch generell würde ich nicht sagen, dass das Machtgefälle kleiner geworden ist. Berühmte Personen etwa kommen immer noch überproportional oft in den Medien vor. Aber sie haben eine Rolle, eine Aufgabe. Somit ist dies legitim und bringt auch eine gewisse Stabilität.
«Eine Abstimmung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, ist eine gewaltige Leistung der Medien.»
Wie wichtig ist der Dialog zwischen Medien und Bevölkerung?
Medien haben trotz Social Media weiterhin eine wichtige Rolle inne, gerade was Abstimmungskämpfe angeht. Medien garantieren den Austausch von Argumenten, indem sie verschiedene Sichtweisen und unterschiedliche Ansichten aufzeigen. Dieser Prozess ist allen Beteiligten bekannt: Nähern sich Abstimmungen, bilden Parteien Parolen, werden Argumente formuliert – und dank dem vorhandenen Erfahrungsschatz weiss man, welche Argumente beim Publikum funktionieren und welche nicht. Die Argumente werden entsprechend vorbereitet und durchgezogen bis zur Abstimmung, was dem Publikum Zeit gibt, die entsprechende Vorlage zu verstehen. Die Medien übernehmen dabei auch eine Qualitätskontrolle, indem sie die Argumente überprüfen und Parteien oder Einzelakteurinnen und -akteure mit anderen Meinungen anhören und, wenn es relevant ist, darüber berichten. Eine Abstimmung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, ist eine gewaltige Leistung der Medien. So stellen sie gewisse Debatten her, setzen Standards für die Debattenqualität. Und sie machen das gut. Ich finde, das ist weltweit das Beste, was man erreichen kann, mehr liegt in puncto öffentlichen Dialogs nicht drin.
Wo sehen Sie sonst Verbesserungspotenzial?
Eine andere Aufgabe des Service public könnte sein, selber einen innovativen Beitrag zu den Informationsflüssen zu leisten. Wie können sich Bürgerinnen und Bürger untereinander, aber auch mit dem Staat, mit der Wirtschaft oder mit den Medien austauschen, ohne dass dies durch eine Marktlogik definiert wird? In Taiwan gibt es die Plattform «Pol.is» mit Beiträgen, die eine Lösung bringt. Statt dass der Austausch von Meinungen auf Plattformen grosser US-Unternehmen geschieht, könnte die SRG mit einer Open-Source-Software mit dezentralem Design, wo die Bürgerinnen und Bürger tatsächliche Kontrolle über die Verwendung ihrer persönlichen Daten haben, hierfür die Infrastruktur entwickeln und zur Verfügung stellen. Sie könnte inhouse dafür das Wissen aufbauen. Die öffentlichen Gelder würden somit nicht den Besitzern der Software zugutekommen, sondern der Allgemeinheit. Das wäre ein Weg, den man gehen könnte und der eine Investition wäre für das Land, von der das ganze Publikum profitieren würde.
Das Magazin für Mitglieder
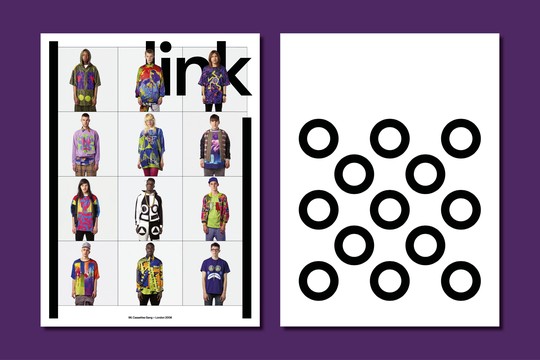
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt anmelden


Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.