Sandro Brotz: Das Publikum ist das Herzstück seiner Arbeit

Als Moderator der «Arena» ist Sandro Brotz den Reaktionen des Publikums so nah wie kaum ein anderer. Ob analog oder digital: Er stellt sich Lob und Kritik – und meistert gleichzeitig den Spagat zwischen Dialog und Abgrenzung.
Zur Person
Zur Person
Sandro Brotz ist seit über 30 Jahren als Journalist tätig. Seit 2019 moderiert er die «Arena» bei SRF, davor war er Moderator bei der «Rundschau». Bevor er zu SRF kam, hatte er unter anderem bei Radio 1, Ringier und den AZ Medien gearbeitet.
Haben Sie auch eine eigene Meinung?» und «Müssen Sie die Leute so häufig unterbrechen?» – das sind Fragen, die Sandro Brotz fast täglich gestellt bekommt. Ob im Zug, im Restaurant oder während Führungen durch das SRF-Studio: Der «Arena»-Moderator wird regelmässig auf seine Arbeit angesprochen. Dieser direkte Kontakt prägt seinen Alltag und zeigt, wie eng er mit seinem Publikum verbunden ist. «Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer sind positiv eingestellt und einfach neugierig», sagt Brotz.
Doch die Nähe hat auch ihre Schattenseiten. Vor allem in der anonymen Welt der sozialen Medien wird der Ton zunehmend rau, die Hemmschwellen sinken. Und so steht Brotz, der seit 2019 das politische Flaggschiff der SRF-Informationssendungen moderiert, immer wieder im Zentrum hitziger Debatten. Für ihn ist der Job deshalb zum Balanceakt zwischen professionellem Dialog und persönlicher Abgrenzung geworden. Als die «Arena» vor über drei Jahrzehnten zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, erreichten Rückmeldungen die Redaktion auf klassischen Wegen: per Telefon oder Post. Briefe von Zuschauerinnen und Zuschauern gibt es auch heute noch – die grosse Mehrheit der Zuschriften machen aber E-Mails, Direktnachrichten und Kommentare auf Instagram, LinkedIn oder X (ehemals Twitter) aus.
«Wir haben dadurch einen aktiveren, direkteren Austausch, der viel schneller und vielfältiger ist», erklärt Brotz. Mit der zunehmenden Geschwindigkeit und der Anonymität hat sich allerdings auch der Ton verschärft. Besonders seit der Pandemie beobachtet Brotz eine Verrohung der Kommunikation: «Die Hemmschwellen sind klar gesunken. Viele sehen Journalistinnen und Journalisten als Handlanger des Staates. Manche Nachrichten sind deshalb wirklich unter der Gürtellinie.» Heikle Themen wie Migration, das Gesundheits- oder das Rentensystem lösen beim Publikum besonders viele Reaktionen aus. Dabei vergessen manche, dass Brotz als «Arena»-Moderator nicht sich selbst vertritt.
«Ich sehe mich als Anwalt des Publikums, der kritisch zurückfragt, wenn meine Gäste auszuweichen versuchen.»
Nicht jede Kritik sei fundiert. Immer wieder wird Brotz pauschal als «links» abgestempelt. «Kürzlich schrieb mir jemand, dass ich parteiisch moderiert hätte. Als ich ihn aufforderte, mir konkrete Beispiele zu schicken, konnte er kein einziges nennen. Es sei einfach ein Gefühl gewesen, schrieb er mir dann zurück. Damit kann ich natürlich wenig anfangen.» Brotz hat gelernt, sich abzugrenzen. «Ich bin mittlerweile sehr gut darin, Feedback auf seinen tatsächlichen Gehalt zu scannen. Wenn ich merke, dass es nirgendwo hinführt, landet die Nachricht im Papierkorb», erklärt er. Auch auf Social Media wägt er immer stärker ab, auf welche Diskussionen er eingeht und welche er an sich vorbeiziehen lässt. Denn nicht jeder Kommentar führt zu einem konstruktiven Austausch. Im Gegenteil: Manche Diskussionen werden durch die Meinungsäusserung des prominenten Moderators unnötig aufgeheizt. Besonders die Plattform X, auf der Brotz immer häufiger aggressive Auseinandersetzungen beobachtet, meidet er mittlerweile zunehmend. «Ich bin nur noch vor und nach Sendetagen kurz online. Die gehässige Stimmung dort tut mir nicht gut.» Diese bewusste Distanz hilft ihm, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken – nämlich die Inhalte seiner Sendung
Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Austausch mit dem Publikum für Brotz die DNA der «Arena». Und zwar auch analog. Woche für Woche kommen 100 Menschen ins Studio, verfolgen die Diskussion live und werden selbst Teil der Debatte. «Vor der Sendung gibt es eine Führung durch das Haus, danach einen Apéro mit allen Gästen, während dem ich mir viel Zeit für Gespräche nehme», erzählt Brotz. «Das ist fordernd, aber auch extrem bereichernd.» Für Brotz ist klar: Das Publikum ist das Herzstück seiner Arbeit. «Ohne die Zuschauerinnen und Zuschauer wären wir nichts. Ihr Interesse, ihre Kritik, ihr Lob – all das zeigt, dass wir relevant sind.»
Die «Arena» und sich selbst versteht er als Dienstleister, die relevante Themen für Staatsbürgerinnen und -bürger zugänglich und verständlich machen – auch oder gerade dann, wenn sie nicht einfach sind. «Die Welt wird immer komplexer. Wir leisten Übersetzungsarbeit und versuchen, Themen auf so vielschichtige Art zu beleuchten, dass das Publikum sich eine eigene Meinung bilden kann. Das ist unser Beitrag zur Demokratie.» Und während der überwiegende Teil des Feedbacks positiv ist, schätzt der erfahrene Moderator auch fundierte Kritik und sieht sie als Chance, daran zu wachsen. Erst kürzlich hat er nach einer Sendung die Rückmeldung erhalten, eine Politikerin mehrfach und zu scharf unterbrochen zu haben. «Der Zuschauer meinte, ich sei zu schulmeisterlich und rechthaberisch aufgetreten. Diese Kritik habe ich sehr ernst genommen.» Solche Momente der Reflexion sind für Brotz zentral, um seine Aussenwirkung immer wieder aufs Neue zu überprüfen. Manchmal erreichen Brotz auch Nachrichten aus unerwarteten Quellen: «Ich bekomme regelmässig Post aus Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken.
Es zeigt, dass der Journalismus immer noch eine wichtige Rolle spielt und manche Menschen uns als ihre letzte Anlaufstelle sehen.» Das freut Brotz, auch wenn das Debattenformat «Arena» nicht wirklich Raum bietet, um solche Einzelschicksale aufzugreifen: «Ich bin eben so etwas wie der Briefkasten der Nation"
Das Magazin für Mitglieder
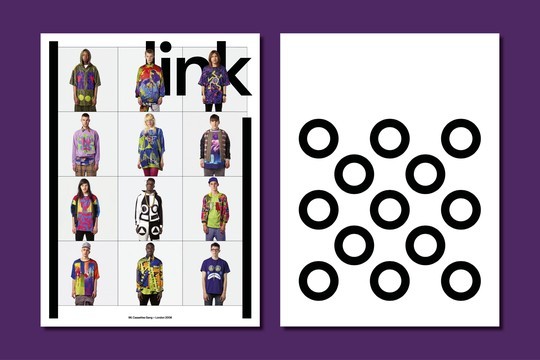
Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.
Jetzt anmelden


Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.