«DOK»-Film «Hüslischweiz ohne Ende» beanstandet (II)
4449
Im Namen des Hauseigentümerverbandes Schweiz (HEV), deren Direktor Sie sind, beanstandeten Sie mit Ihrem Brief vom 19. Dezember 2016 den Beitrag „Hüslischweiz ohne Ende - Mit Kathrin Winzenried unterwegs im zersiedelten Land“, den die Sendung „DOK“ von Fernsehen SRF am 8. Dezember 2016 ausstrahlte.[1]
A. Sie begründeten Ihre Beanstandung wie folgt:
1. Ausgangslage
„In der Sendung DOK vom 8. Dezember 2016 wurde die Reportage ‚Hüslischweiz ohne Ende‘ von Bruno Amrein ausgestrahlt. Im Film spricht die Moderatorin Kathrin Winzenried mit einem Ehepaar, das ein Einfamilienhaus baut, dem Direktor der Vereinigung für Landesplanung VLP Lukas Bühlmann sowie einem Pächter von Landwirtschaftsverband der Stadt Bern über die Zersiedelung der Schweiz sowie die Frage, wie viel Wohnfläche gebraucht wird.
2. Unausgewogene und einseitige Berichterstattung
Der HEV Schweiz vertritt die Interessen von ca. 335‘000 Eigentümern und Vermietern und ist mit Abstand der grösste Vertreter von Wohneigentümern in der Deutschschweiz. Es irritiert, dass der HEV Schweiz aufgrund dieser Position nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde und es wird ausdrücklich festgehalten, dass die Berichterstattung in der erwähnten Sendung als äusserst einseitig empfunden wurde.
Eine junge Familie, die sich den Traum vom Einfamilienhaus erfüllt, repräsentiert in der Sendung den typischen Wohneigentümer. Die Familie wird mit einer Reihe von Suggestivfragen konfrontiert, die implizieren, dass sie eine überhöhte Wohnfläche für sich beansprucht. Das sich im Bau befindliche Haus weist eine Fläche von 180 m2 auf und soll dereinst vier Personen beherbergen. Dies ergibt 45 m2 pro Person und entspricht somit dem durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch pro Person in der Schweiz. Dennoch fragt die Moderation, ob das Ehepaar nicht das Gefühl habe, ‚zu viel Platz zu beanspruchen‘.
Die Suggestivfragen der Moderatorin implizieren ausdrücklich, dass Eigentümer, die ein (grösseres) Einfamilienhaus oder allgemein eine Immobilie besitzen, die grosszügig gebaut ist, mitverantwortlich sind für die bemängelte für die bemängelte Zersiedelung. Dabei wird generell ausser Acht gelassen, dass beispielsweise bei Einfamilienhäusern oftmals nur geringe Flächen bebaut sind und der Grossteil des Grundstücks als Garten genutzt wird. Derartige Nutzungen tragen auch zum entsprechenden Ortsbild bei.
Im Verlauf der Sendung werden immer wieder Luftaufnahmen aus den 50er Jahren mit heutigen Luftbildern verglichen, auf denen das Wachstum der Ortschaften gut sichtbar ist. Dabei bleibt jedoch unerwähnt, dass die Schweiz ein enormes Bevölkerungswachstum (von 4,6 Mio. auf 8,2 Mio.) zu verzeichnen hatte, der den Bau und das Wachstum von bestehenden Städten und Ortschaften unausweichlich machte. Nicht nur die Entwicklung der Schweiz von einem Agrar- zu einem Industrie- und letztlich zu einem Dienstleistungsland bleibt unerwähnt, auch der Wirtschaftsaufschwung, den die Schweiz im letzten Jahrhundert erleben durfte, war keine Erwähnung wert. Der Film suggeriert vielmehr, insbesondere Einfamilienhausbesitzer würden aus purer Verschwendungssucht so viel Platz beanspruchen. Es wird auch nicht erwähnt, dass das gegenwärtige Mietrecht mit den restriktiven Bestimmungen zur Mietpreiserhöhung in bestehenden Verträgen ebenfalls einen Anreiz zum Überkonsum von Fläche darstellt.
Ebenfalls unerwähnt bleibt, dass der Bund lange Zeit eine Strategie der dezentralen Entwicklung der Landesteile verfolgte, was die Zersiedelung genauso stark mitgeprägt hat, wie die schwache Umsetzung der bestehenden Gesetze in den Gemeinden. Hinzu kommt eine Veränderung der Haushaltsgrösse (Demographie) sowie der allgemeine Wohlstandszuwachs, welche ebenfalls Treiber des steigenden Wohnflächenkonsums sind. Eine nüchterne Betrachtung der Arealstatistik des Bundes ergibt zudem, dass die Siedlungsfläche 8% der Landesfläche ausmacht (Landwirtschaft 35 %, Wald 31 %, Unproduktive Flächen 25 %). Auch diese Tatsachen wurden nicht erwähnt.
Der einzige präsentierte Lösungsansatz ist eine genossenschaftliche Wohnsiedlung. Diese stellen längst nicht die einzige Möglichkeit für verdichtetes Bauen dar und sind auch nicht in genügender Anzahl vorhanden, dass alle Leute so wohnen könnten. Daher wäre es wünschenswert gewesen, die Sendung hätte weitere Beispiele für Verdichtung gezeigt. Ausserdem wäre es wichtig gewesen, aufzuzeigen, welche Faktoren Verdichtung immer wieder verhindern (Heimatschutz, Ortsbild, kein Aufstocken in Städten möglich, eng gefasste Richtpläne in den Städten, Einsprachen von Anwohnern etc.).
Insbesondere nimmt die Berichterstattung zum bestehenden Problem nur wenig Bezug. Das bestehende Raumplanungsgesetz, das vom Volk gutgeheissen wurde, hat sich der Problematik angenommen und bietet adäquate Lösungen. Das grosse Problem, nämlich die mangelnde bzw. fehlende Umsetzung durch die Gemeinden, bleibt hingegen nahezu unerwähnt. Es ist und bleibt die Aufgabe der zuständigen Gremien und Personen, für eine ordnungsgemässe Umsetzung zu sorgen, um die Zersiedelung zu stoppen. Im Rahmen dessen kann sich sodann auch jeder sein Traum von einer eigenen Immobilie erfüllen. Diesbezüglich sei erwähnt, dass auch heute noch rund 72% der Schweizer gerne ein Einfamilienhaus besitzen würden, es ist und bleibt die beliebteste Wohnform.
3. Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Sendung das Thema Zersiedelung sehr einseitig beleuchtet und sehr viele Tatsachen und Argumente ausblendet. Zusammen mit den suggestiven Fragen der Moderatorin und der melancholischen Musik entsteht der Eindruck, der Zuschauer solle sich eine ganz bestimmte Meinung bilden, nämlich die, dass viele Eigentümer ein überzogenes Flächenbedürfnis haben. Die gezeigte Lösung in Form der Genossenschaftsbauten lässt das bestehende Problem, nämlich die mangelnde Umsetzung der bestehenden Rechtsgrundlage, völlig ausser Acht. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die erwähnte Berichterstattung unausgewogen und beeinflussend erfolgt.“
B. Die zuständige Redaktion erhielt Ihre Beanstandung zur Stellungnahme. Für sie antwortete Frau Nathalie Rufer, stellvertretende Bereichsleiterin Dokumentarfilm und Reportage von Fernsehen SRF, wie folgt:
„Zur Beanstandung von Herrn Y vom Hauseigentümerverband Schweiz HEV vom 19. Dezember 2016 betreffend den Dokumentarfilm ‚Hüslischweiz ohne Ende‘ vom 8. Dezember 2016 nehme ich gerne Stellung.
Vorbemerkung: Beim beanstandeten Film handelt es sich um einen historischen Rückblick auf die Siedlungsentwicklung in der Schweiz während der letzten Jahrzehnte und wie sich das Landschaftsbild dadurch verändert hat. Im Fachjargon spricht man bei dieser Entwicklung von Zersiedelung: das ungeregelte Wachstum von Ortschaften in unbebauten Raum hinein, bedingt durch die steigenden Bedürfnisse nach Fläche.
Sechs Protagonisten stehen in diesem Beitrag im Zentrum, die von der Moderatorin Kathrin Winzenried befragt werden. Es sind dies Lukas Bühlmann, Direktor Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP-ASPAN), Hans Matter, Landwirt, Kurt Rütti, ehemaliger Gemeindepräsident von Egerkingen, Peter Brotschi, Aviatik-Journalist, Familie Arnold, Einfamilienhausbesitzer, Familie Ris, Mieter in einem Mehrfamilienhaus.
Zu den einzelnen Kritikpunkten:
1. Der HEV bemängelt, dass der Verband im Film nicht zu Wort kam. Wie eingangs erwähnt, ging es im Dokumentarfilm um eine historische Betrachtung der Siedlungsentwicklung in der Schweiz. Nicht um eine kontroverse Diskussion, ob Mieter oder Hauseigentümer Verursacher der Zersiedelung sind. Eine Frage, die sich so auch nicht stellt. Es macht keinen Sinn, den HEV zu befragen, wenn es um die generelle Ausdehnung der Siedlungsfläche geht, die seit Jahrzehnten rascher wächst als die Bevölkerung.[2]
2. Warum wurde das Ehepaar Arnold nach seinem Flächenbedarf befragt? Gemäss übereinstimmender Expertenmeinung (ETH, VLP-ASPAN etc.) ist der gestiegene Wohnflächenbedarf pro Person einer der Hauptverursacher der Zersiedelung. Andere sind das Bevölkerungswachstum, die Flucht ins Grüne, wiederum angekurbelt durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Strassennetzes. Insofern war die Frage der Moderatorin nach dem benötigten Raum durchaus legitim, wenn nicht zwingend. Im Übrigen störte sich die Familie überhaupt nicht an dieser Frage und war mit der Berichterstattung sehr zufrieden. Wenn Herr Y als Argument ins Feld führt, dass <nur geringe Flächen bebaut sind und der Grossteil des Grundstücks als Garten genutzt wird>, steht dies im Widerspruch zur Problematik. Wenn wir von Zersiedelung sprechen, basiert dies auf drei Messgrössen: der Streuung der Siedlungsflächen (Dispersion DIS), der urbanen Durchdringung (UP), welche die Siedlungsfläche berücksichtigt, und der Einwohner- und Arbeitsplatzdichte (Ausnützungsdichte AD). Die Zusammenführung und Gewichtung dieser Messgrössen ergibt den Wert der Zersiedelung[3].
Mit anderen Worten: Eine wirksame Eindämmung der Zersiedelung verringert die Gefahr eines weiteren Anstiegs des Landschaftsverbrauchs, und da wird eben auch der Privatgarten der Arnolds miteingerechnet. Dass der HEV diese Einfamilienhausgärten als Bereicherung für das Ortsbild betrachtet, ist Ansichtssache, hat aber mit der eigentlichen Thematik des Films nichts zu tun.
Der HEV moniert, dass verschiedene Faktoren, die zur Zersiedelung beitragen, unerwähnt bleiben. Das ist eine generelle Unterstellung und entspricht nicht den Aussagen im Film. Das gestiegene Bevölkerungswachstum wurde ebenso erwähnt (wenn auch nicht mit konkreten Zahlen, die sind allgemein bekannt), wie auch die Entwicklung der Schweiz vom Agrar- zum Dienstleistungsland und das damit verbundene Wirtschaftswachstum. Dieser Strukturwandel wird sowohl mit historischen Aufnahmen, als auch mit dem Besuch beim ehemaligen Gemeindepräsidenten von Egerkingen dokumentiert. Herr Rütti erzählt ausführlich darüber, wie sich sein Dorf während der letzten Jahrzehnte vom Bauerndorf zum Wirtschaftsstandort gewandelt hat. Auch die schwache Umsetzung des Raumplanungsgesetzes wird exemplarisch am Beispiel Egerkingen thematisiert: Herr Rütti bestätigt, dass die Gemeinde bezüglich der Bautätigkeit vom Kanton nie in die Schranken gewiesen worden sei. Auch das Archivstück zur geplanten Überbauung ‚Galmiz‘ thematisiert die Verletzung des Raumplanungsgesetzes durch Kantone und Gemeinden. Zudem ergänzt der Raumplanungsexperte Lukas Bühlmann im Film, dass, bei sachgemässer Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes, die Zersiedelung zwar nicht gestoppt, aber gebremst werden könne.
Weiter stört sich der HEV daran, dass die Arealstatistik des Bundes zur Bodennutzung in der Schweiz im Film nicht explizit erwähnt wird: Das trifft zu. Allerdings ist genau diese Statistik ein Beleg dafür, wie knapp der Siedlungsraum in der Schweiz ist: Wegen der Topographie und des Gesetzes (Waldgesetz) sind es nur die ca. 35 % Landwirtschaft, die als künftige Siedlungsfläche überhaupt noch in Frage kommen. Dieser Zielkonflikt ‚Siedlungsfläche vs. Nahrungsgrundlage‘ wurde im Film ausgeführt anhand der Umzonungsvorlage ‚Viererfeld‘ in Bern.
Dass das gegenwärtige Mietrecht laut dem HEV im Zusammenhang mit dem Thema Zersiedelung hätte erwähnt werden müssen, entbehrt jeglicher Grundlage: Gerade in den Städten, wo die Mietpreise teils enorm hoch sind, ist der Flächenverbrauch pro Kopf weit geringer als im Schweizerischen Durchschnitt (siehe Stadt Zürich).
3. Herr Y vom HEV ist der Meinung, dass im Film nur ein einziger Lösungsansatz präsentiert wird, wie der Zersiedelung beizukommen wäre. Das trifft nicht zu. Nebst der Genossenschaftssiedlung in Zürich-Schwamendingen wurde auch die Neugestaltung der Industriebrache in Luterbach im Kanton Solothurn in diesen Kontext gestellt. Luterbach gilt unter Raumplanern als ‚Leuchtturmprojekt‘, wie Kantone und Gemeinden mit aktiver Bodenpolitik die Zersiedelung drosseln könnten. Zudem ist auch die im Film thematisierte Überbauung ‚Viererfeld‘ ein Lösungsansatz für Städte, wie dem Bevölkerungswachstum in Einklang mit dem Raumplanungsgesetz Rechnung getragen werden kann.
Abschliessend halte ich fest, dass das Thema des Films meines Erachtens von mehreren Seiten und differenziert beleuchtet wurde. Dies zeigt schon die Auswahl der Protagonisten/ Interviewpartner. Natürlich kann in einer 50-minütigen Sendung nicht jeder Aspekt des komplexen Themas vertieft behandelt werden. Die positiven Rückmeldungen aller im Film vorkommenden Personen ist Indiz dafür, dass es den Autoren gelungen ist, ausgewogen und fair über das Thema Zersiedelung zu berichten.
Der Film verstösst meiner Meinung nach nicht gegen die Konzession und die ZuschauerInnen konnten sich eine eigene Meinung bilden. Das Sachgerechtigkeitsgebot wurde nicht verletzt. Eine Stellungnahme von Seiten des HEV war keineswegs zwingend.
Ich bitte Sie deshalb, die Beanstandung abzuweisen.“
C. Soweit die Ausführungen von Frau Rufer. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Ich verstehe recht gut, dass Sie angesichts dieser Sendung die Hände verworfen und sich gesagt haben: „Das ist unser Thema, und der Hauseigentümerverband wird nicht gefragt?“ Da kommen Wut und Frust auf. Kommt dazu, dass Sie der Meinung sind, dass nicht alle zentralen Aspekte des Themas Zersiedelung behandelt wurden.
Keine Frage: Der Hauseigentümerverband Schweiz ist der wichtigste Verband der Hausbesitzer – zumindest in der Deutschschweiz. Er ist deren Lobby, und es ist legitim, dass Sie jene Aspekte betonen, die aus der Sicht der Immobilien-Eigentümer wichtig sind. Wenn es um politische Entscheidungen geht, die Mieter und Hauseigentümer betreffen, wäre es ein Affront, wenn der HEV Schweiz in einer Expertenkommission oder in der Vernehmlassung nicht begrüsst würde. Auch in einer „Arena“-Sendung zur Raumplanung, in der die verschiedenen politischen Kontrahenten diskutieren, müsste einer der Politiker oder Politikerinnen, die im Vorstand des HEV Schweiz sitzen, mit von der Partie sein. Ein wenig anders ist es bei einer Reportage. Reportagen leben vom Augenschein. Und dort treffen die Reporter auf Menschen, die in ganz konkreten Situationen konkrete Probleme bewältigen. Also eben eher auf ein junges Paar, das ein Haus baut, oder auf einen Landwirt, der gegen die Überbauung von Kulturland kämpft, auf den Aviatik-Journalisten, der die Schweiz von oben fotografiert, oder auf Bewohner einer Genossenschaftssiedlung. Hier könnte man einwenden, dass aus dieser Optik Lukas Bühlmann als Direktor des VLP-ASPAN Verbandes für Raumplanung Schweiz oder Alex Tschäppät als Stadtpräsident Berns auch nicht hätten vorkommen dürfen, da sie auf ähnlicher Ebene agieren wie Ihr Verband. Das stimmt! Was aber richtig bleibt ist, dass die Reportage eher vom Individuell-Konkreten ausgeht als vom Generell-Abstrakten und dass sie Organisationen und Funktionäre nur soweit einbezieht, wie es für das Verständnis des Themas nötig ist.
Dennoch: Auch ich meine, dass man das Thema noch umfassender, noch variantenreicher hätte angehen können als es DOK gemacht hat. Nur: Es handelte sich um eine einzige Reportage, nicht um eine ganze Serie. Journalismus wählt immer aus. Die Frage ist also, ob zentrale Aspekte fehlten, so dass sich das Publikum nicht frei eine eigene Meinung bilden konnte, sondern bewusst manipuliert wurde.
In zwei Punkten stimme ich Ihnen zu:
- Man hätte das Dilemma der Schweiz noch stärker betonen sollen: Die Schweiz ist ein Land ohne Rohstoffe. Ihre Wertschöpfung gewinnt sie durch Bildung, Dienstleistung sowie durch Präzisions- und Spitzenindustrie im Bereich Uhren, Maschinen, Chemie, Elektronik, die vor allem Export betreibt. All das bedingte seit Jahrzehnten Wachstum und ausländische Arbeitskräfte. Die Bevölkerungszunahme hatte wiederum Auswirkungen auf die Infrastruktur: Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden nicht nur so viele Einfamilienhäuser gebaut wie noch nie, sondern auch so viele Wohnblöcke und Appartementhäuser wie noch nie, Industrieanlagen, Schulhäuser, Spitäler, Universitätsgelände, Sportanlagen, Autobahnen, Eisenbahnlinien, Bergbahnen, Hotels. Das Bedürfnis nach Wohlstand erfordert wirtschaftliche und infrastrukturelle Dynamik, und diese geht mit der Zersiedelung einher. Hier wurde die Schuld für den Verlust an Kulturland zu einseitig dem Bau von Einfamilienhäusern gegeben.
- Man hätte deutlicher darauf hinweisen können, dass die Gemeinden es in der Hand haben, mit der konsequenten Umsetzung des Raumplanungsgesetzes die Zersiedelung zu bremsen.
Im Übrigen hat der Film das Problem sehr anschaulich und vielfältig auf den Punkt gebracht. Es lag im Rahmen der Programmautonomie, das Thema auf diese Weise anzugehen, und insgesamt konnte sich das Publikum frei eine eigene Meinung bilden. Die Sachgerechtigkeit wäre indes noch vollkommener erfüllt gewesen, wenn auch die zwei kritischen Punkte stärker berücksichtigt worden wären. Aus diesem Grund kann ich Ihre Beanstandung zumindest teilweise unterstützen.
D. Diese Stellungnahme ist mein Schlussbericht gemäß Art. 93 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) orientiert die beigelegte Rechtsbelehrung. Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
[1] http://www.srf.ch/play/tv/dok/video/hueslischweiz-ohne-ende?id=cae6f6c8-59d1-44b0-94eb-d7ce980c54e0
[2] https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/grundlagen-und-daten/fakten-und-zahlen/siedlungsflaechen.html).
[3] http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/08612/12916/index.html?lang=de

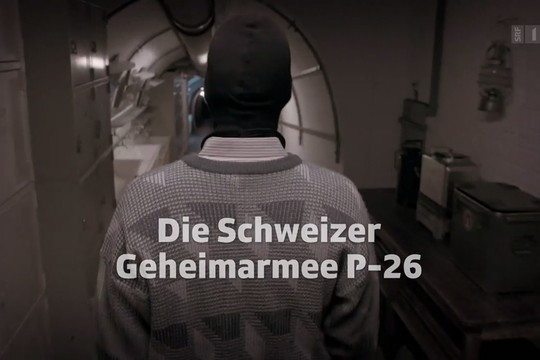
Kommentar