Fernsehen SRF, Sendung «DOK» vom 31. Mai 2017, «Israel und die Ultraorthodoxen» beanstandet III
5108
Mit Ihrem Brief vom 15. Juni 2017 beanstandeten Sie die Sendung „DOK“ des Fernsehens SRF vom 31. Mai 2017 zum Thema „Israel und die Ultraorthodoxen“.[1] Ihre Eingabe entspricht den formalen Anforderungen an eine Beanstandung. Ich kann folglich darauf eintreten.
A. Sie begründeten Ihre Beanstandung wie folgt:
„Ich beanstande die Missachtung des Sachgerechtigkeitsgebotes, weil ein wichtiges Element des TV-Beitrages tatsachenwidrig dargestellt wurde, nämlich die Anzahl der ultraorthodoxen Juden, die in Israel wohnen, den Staat als solchen faktisch ablehnen, den Militärdienst verweigern, anstelle einer Erwerbstätigkeit nur Thora-Studium betreiben (auf Männer beschränkt), in der aktuellen Regierung mehrere Ministerposten innehalten, dem früheren iranischen Präsidenten Ahmadineschad den Hof machten und wegen der massiv überdurchschnittlichen bevölkerungsmässigen Vermehrung zunehmend eine grosse Gefahr für die innere Sicherheit und die Zukunft des Staates darstellen.
Im Dok-Film war konstant die Rede von über einer Million derartiger ultraorthodoxer Bewohner des Staates Israel einschliesslich der - auch aus meiner Sicht als hinterfragungswürdig angesehenen – neuen Siedlungen im Westjordanland.
Am 8. Juni fand in Bern ein parlamentarisches Meeting zwischen einer Delegation von Knesset-Mitgliedern und der CH-Parlamentariergruppe Schweiz – Israel statt. In der gegenseitigen Aussprache war auch dieser Film ein Thema. Seitens der Knesset-MP’s wurde uns glaubhaft versichert, das die im Film dargestellte Schilderung höchstens auf einige Hundert ‚extreme‘ Ultraorthodoxe zutreffe. Ein zusätzliches Gespräch vom 14.06.2017 mit dem Botschafter Israels in Bern, um das ich nachgesucht hatte, bestätigte mir die völlig tatsachenwidrige Behauptung des TV-Beitrages, was den zahlenmässigen Anteil dieses ‚extremen‘ Bevölkerungsanteils in Israel anbetrifft. Der ultraorthodoxe Anteil der Bevölkerung Israels beträgt sehr wohl eine Million, er gliedert sich aber in diverse Strömungen. Der im Film dargestellte Teil betrifft aber lediglich eine extreme Gruppierung von offensichtlich weniger als 1‘000 Personen.
Somit orte ich eine krasse Missachtung des Sachgerechtigkeitsgebotes gegenüber den TV-Zuschauern in der Schweiz wie auch gegenüber dem Staat Israel. Der Film konzentriert sich auf das Extreme, verzerrt damit das Gesamtbild und unterschlägt die Tatsache, dass im streng orthodoxen Judentum der Trend zur Erwerbstätigkeit und zur Leistung von Militärdienst heute klar nach oben zeigt.
Ich bitte die Ombudsstelle, beim weitgehend von der Öffentlichkeit ‚zwangsfinanzierten‘ TV-SRF dahin zu wirken, dass eine Richtigstellung in angemessener Weise ausgestrahlt wird.“
B. Die zuständige Redaktion erhielt Ihre Beanstandung zur Stellungnahme. Frau Belinda Sallin, Redaktionsleiterin DOK Eigenproduktionen, äußerte sich wie folgt:
„Gerne nehmen wir zur Beanstandung von Herrn Nationalrat Maximilian Reimann vom 15. Juni 2017 zum Dokumentarfilm ‚Israel und die Ultraorthodoxen‘ in der Sendung ‚DOK‘ Stellung. Herr Reimann moniert die Missachtung des Sachgerechtigkeitsgebotes. Er kritisiert, dass im Film <konstant die Rede von über einer Million derartiger ultraorthodoxer Bewohner des Staates Israel (...)> sei. Im nächsten Abschnitt seiner Beanstandung präzisiert Herr Reimann: <Der ultraorthodoxe Anteil der Bevölkerung Israels beträgt sehr wohl eine Million, er gliedert sich aber in diverse Strömungen.>
Im Film wird nie etwas anderes behauptet. Es wird in einem ersten Schritt sorgfältig erklärt, was mit dem Begriff ‚ultraorthodox‘ eigentlich gemeint ist. Die Filmautorin Bethsabée Zarka geht, entsprechend gekleidet, mit der französisch-israelischen Journalistin Laly Derai, welche für eine ultraorthodoxe Zeitung arbeitet, ins Viertel Mea Shearim und lässt sich die Grundlagen des ultraorthodoxen Judentums erklären. Im Filmkommentar heisst es: <Wir dringen in eine geschlossene Welt ein. Hier leben nur Ultraorthodoxe. Ihre Kleidung und die Art, wie sie das Judentum leben, stammen aus dem Europa des 18. Jahrhunderts. Damals mussten die Juden Osteuropas vor den Pogromen flüchten und liessen sich hier nieder. Lange vor der Gründung des Staates Israel.> (TC 4.46) O-Ton Laly Deray: <Die Kleider, die Sie hier sehen, sind genau dieselben, welche schon vor 200 Jahren ihre Vorfahren getragen haben. Dieselben Kleider zu tragen ist ein Mittel der Ultraorthodoxen, um ihre Eigenständigkeit zu wahren. Für sie würde es Anpassung bedeuten, wenn sie sich gleich wie die nicht religiösen Juden kleiden würden. Es ist für sie Ehrensache, sich heute noch so zu kleiden.> (TC 5.21). Im Filmkommentar heisst es weiter erklärend: <Radio, Fernsehen und Internet sind verboten. Damit sie sich dennoch informieren können, werden Aushänge an die Mauern gehängt.> (5.52)
Die im Dokumentarfilm thematisierte Gemeinschaft der ultraorthodoxen Juden stellt sich im Übrigen selber auch genauso dar. Auf Fragen der Dokumentarfilmerin reagieren sie sehr ablehnend, die beiden Journalistinnen werden – gemäss den Regeln der Gemeinschaft – nicht angeschaut, da sie Frauen sind, die Kamera ist eine grosse Provokation für die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels und teilweise wird sogar mit einem Rayon-Verweis gedroht.
Gerne verweisen wir an dieser Stelle auch auf die Begriffsklärung der ‚Gesellschaft gegen Rassismus und Antisemitismus‘, welche festhält: < Als ultraorthodox werden jene Gemeinschaften orthodoxer Juden bezeichnet, die sich von der modernen Welt abschirmen.>[2]
Der Begriff ‚ultraorthodox‘ bezeichnet also per definitionem einen, nach westlich-demokratischen Massstäben, ‚extremen‘ Lebensstil, der sich streng nach den von der Religion vorgegebenen Regeln, Geboten und Verboten richtet.
Keineswegs wurde im Film aber behauptet, dass die Glaubensgemeinschaft der Ultraorthodoxen eine einheitliche sei. Gleich zu Beginn des Films heisst es im Filmkommentar: <Hier wohnen 15‘000 Ultraorthodoxe, unter ihnen die radikalsten.> (TC2.50). Dieser Kommentar macht von Anfang an deutlich, dass nicht alle Menschen, die einer ultraorthodoxen Gemeinschaft angehören, gleich radikal sind.
Es kommen im Film Vertreter verschiedener ultraorthodoxer Gruppierungen zu Wort, so zum Beispiel die Gemeinschaft der Naturei Karta (TC 16.58), deren Rabbiner der Filmautorin auch ein Interview gewährt. Zu den Naturei Karta heisst es im Film: >Es gibt sektenartige Gruppierungen unter den Ultraorthodoxen, die noch weiter gehen: sie streben die Zerstörung des Staates Israel an. Denn für sie wird es erst einen Staat Israel geben, wenn der Messias gekommen ist. Naturei Karta, übersetzt ‚Hüter der Stadt‘, heisst eine dieser fundamentalistischen Gruppierungen. Jedes Jahr verbrennen sie am Nationalfeiertag die Flagge Israels und halten die Flagge Palästinas hoch. Eine Provokation an die Adresse des Staates Israel.> Es ist zu jedem Zeitpunkt völlig klar, dass es sich hier um eine Gruppierung innerhalb der Ultraorthodoxen handelt und keinesfalls um alle ultraorthodoxen Juden.
Es wird im Film gezeigt, dass die Gemeinschaft der Ultraorthodoxen in Israel ihre Gesinnung und ihren Lebensstil zunehmend auch auf Andersdenkende übertragen wollen. So dokumentiert der Film zum Beispiel, wie eine Gruppe von Ultraorthodoxen die Schliessung eines Marktes in Jerusalem erzwingt (TC 20.16). Mit Trompetenlärm bringt eine Gruppe von Ultraorthodoxen die Händler dazu, ihre Stände zu schliessen. Alle müssen gehorchen, ob orthodoxe oder nicht strenggläubige Juden, ob Säkulare, Muslime oder Christen. Dies mag eine kleine Gruppe Ultraorthodoxer sein, welche hier auftritt, sie steht jedoch für Vorgänge, die sich in Israel regelmässig und mit grossem Einfluss auf die gesamte Bevölkerung des Landes zutragen.[3] Die Filmautorin versuchte im Übrigen auch hier, nach allen journalistischen Regeln, mit den Ultrareligiösen ins Gespräch zu kommen, ihre Fragen blieben jedoch unbeantwortet.
Auch in der Politik nehmen Ultraorthodoxe vermehrt Einfluss. Im Film wird dies anhand der Berufung des Ultraorthodoxen David Azoulay an die Spitze des Ministeriums für Religions-Angelegenheiten thematisiert (TC 31:50). Die Sequenz zeigt, welche Folgen dies für das demokratische Gefüge Israels hat. Nicht religiöse Menschen befürchten hier einen Einfluss auch auf zivilrechtliche Angelegenheiten wie Eheschliessungen und Scheidungen, was innerhalb des israelischen Parlaments zu politischen Auseinandersetzungen führt – auch dies wird im Film dokumentiert (TC 33:12). Im Kommentar heisst es: < Die Ultraorthodoxen befolgen das jüdische Gesetz auf den Buchstaben genau. In Bezug auf Scheidungen bedeutet dies, dass nur der Mann die Befugnis hat, die Scheidung in die Wege zu leiten – und zwar vor einem religiösen Gericht.>
Diese Ungleichheit führt im israelischen Parlament zu kontroversen Debatten. Im Film liefert sich die Abgeordnete Rachel Azaria einen verbalen Schlagabtausch mit dem Leiter des religiösen Gerichts, dem ultraorthodoxen Rabbiner Shimon Yaacobi (TC 33:12).
Es ist eine Tatsache, dass die ultraorthodoxe Bevölkerung wächst, viele Familien sind sehr kinderreich. Die Autorin Bethsabée Zarka im Interview mit DOK: < Die ultraorthodoxe Bevölkerung wächst rasant: 6,5 Kinder pro Frau im Gegensatz zu 3,5 Kinder bei der durchschnittlichen Israelin.>
Im Film wird gezeigt, dass dies mit einem erhöhten Raumbedarf einhergeht, was dazu führt, dass viele Viertel ultraorthodox werden und Säkulare verdrängt werden. Dies bestätigt auch der Protagonist Yonatan Steinberger, der mit seiner Familie im Viertel Maalot Dafna lebt: <Hier waren früher alle säkular, also weltlich. Heute lebt hier kein einziger säkularer Jude mehr. Es gibt noch ein paar wenige moderat Religiöse, dort drüben, aber das ist alles. Wenn die Ultraorthodoxen in grosser Zahl kommen, dann verlassen die Säkularen das Quartier. Heute gibt es einen enormen Graben zwischen den Ultraorthodoxen und den Säkularen. Wir können keine Nachbarn sein.> (TC 15.08).
Gleich zu Beginn des Films ist ein enormer Aufmarsch an Ultraorthodoxen anlässlich einer Demonstration im Jahr 2014 zu sehen. Zu Tausenden versammelten sich in Jerusalem Gleichgesinnte, um mit kämpferischen Parolen gegen die israelische Regierung zu protestieren. Grund: Die Beteiligung am Militärdienst, von der Ultraorthodoxe bislang ausgenommen waren.
Das Gesetz, welches Ultraorthodoxe zum Militärdienst verpflichten sollte, wurde übrigens zwischenzeitlich ausgesetzt, ultraorthodoxe Parteien sind wieder Teil der Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Dies zeigt, dass der Einfluss der Ultraorthodoxen auf sämtliche Aspekte des Lebens in Israel gross ist.
Diese Einflussnahme der Ultraorthodoxen auf die Lebensbereiche der Andersgläubigen, der nicht- oder nur moderat religiösen israelischen Bevölkerung auf eine Anzahl ‚von offensichtlich weniger als 1000 Personen‘ abzutun, wie Nationalrat Maximilian Reimann schreibt, ist unseres Erachtens der Problematik nicht angemessen.
Der Dokumentarfilm von Bethsabée Zarka hat ein inner-israelisches Thema aufgegriffen, welches im Land selber sehr kontrovers diskutiert wird, oder wie es der Protagonist Yonathan Steinberger formuliert: Es gibt <einen enormen Graben zwischen den Ultraothodoxen und den Säkularen>. Über solche Konflikte zu berichten, gehört zu unseren Aufgaben. Es muss möglich sein, kritisch über alle Glaubensgemeinschaften zu berichten, gleich welcher Religion sie angehören.
Wir sind der Meinung, dass es dem Publikum zu jeder Zeit möglich war, die Protagonisten richtig einzuordnen und sich aufgrund der vermittelten Informationen, Fakten und Meinungen ein zuverlässiges Bild über das Thema des Dokumentarfilms zu machen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Es liegt somit keine Verletzung des Sachgerechtigkeitsgebots vor. Wir beantragen die Beanstandung abzuweisen.“
C. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Sie haben gegen den Film von Bethsabée Zarka vor allem den Vorwurf erhoben, dass die Zahl der Ultraorthodoxen falsch, nämlich zu hoch, angegeben worden sei. Dabei differenzieren Sie im Laufe Ihrer Begründung, dass die Zahl sehr wohl eine Million betrage, dass aber die im Film dargestellte extreme Ausrichtung weniger als 1000 Personen umfasse.
Es wäre gut, Sie könnten sich den Film nochmals ansehen. Dann würden Sie nämlich feststellen, dass Sie den Film entweder nicht aufmerksam genug betrachtet oder ihn danach nicht mehr richtig erinnert haben. Wie Frau Sallin in ihrer Stellungnahme ausführlich darlegt, behandelt der Film den Bevölkerungsteil der ultraorthodoxen Juden in Israel insgesamt und nur in einer relativ kurzen Passage die extreme Ausrichtung, die den Staat Israel ablehnt und deren Vertreter mit dem iranischen Präsidenten Ahmadinedschad und mit dem Hamas-Führer zusammenkamen (Naturei Karta). Alles andere, was Sie in Ihrer Beanstandung dieser extremen Gruppe zuschreiben (die Befreiung vom Militärdienst, der Verzicht auf Erwerbstätigkeit zugunsten des Thora-Studiums, die Vermehrung durch Kinderreichtum und die Beteiligung mit Ministern an der aktuellen Regierung), gilt für die Ultraorthodoxen insgesamt.
Über die Zahl der Ultraorthodoxen werden unterschiedliche Zahlen herumgeboten. Gehen wir dem mal genauer nach. Nach einer Statistik von 2016 teilt sich die Bevölkerung Israels nach Religionen wie folgt auf:

Werden nun die Israelis jüdischen Glaubens weiter differenziert, so gibt es verschiedene Statistiken. Nach der neusten Statistik (von 2017) werden nur drei Strömungen ausgewiesen. Dies kann zweierlei bedeuten: Entweder wurde eine Strömung vergessen, die 36 Prozent ausmacht. Oder nicht alle israelischen Juden waren bereit, ihre religiöse Ausrichtung zu deklarieren. Demgegenüber zeigt eine Erhebung des Pew Research Centers (von 2016), dass 81 Prozent sich eingestuft haben – und zwar in vier Gruppen:

Fakt aber ist, dass die Ultraorthodoxen zunehmend Einfluss auf die israelische Regierung gewinnen, und zwar deshalb, weil die politischen Mehrheitsverhältnisse in Israel prekär sind. Wie fast immer seit der ersten Knesset-Wahl im Jahr 1949 eroberte auch bei der letzten Wahl keine Partei die absolute Mehrheit der 120 Sitze. Stets sind Koalitionen nötig. 2015 bildete die mandatsstärkste Likud (30 Sitze) von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Koalition mit der sozialkonservativen Kulanu (10 Sitze), der nationalreligiösen Ha Bajit haJehudi (8 Sitze), der ultraorthodoxen Schas (7 Sitze) und dem ultraorthodoxen Vereinigten Thora-Judentum (6 Sitze). Somit kommt die Regierungskoalition gerade auf die absolute Mehrheit von 61 Sitzen. Die religiösen (und zum Teil ultraorthodoxen) Parteien sind für die Regierung Netanjahu unentbehrlich; ohne sie verliert sie die Mehrheit und damit die Macht.Aus diesen Angaben lässt sich schließen, dass die Zahl der Ultraorthodoxen nicht eine Million beträgt, sondern dass sie sich zwischen 550‘000 und 600‘000 bewegt – und dass sie wächst. In diesem Punkt war der Film nicht faktengenau.
Es gibt Beobachter, die voraussagen, dass in naher Zukunft nicht mehr die Palästinenser und die arabischen Nachbarn die Hauptbedrohung für den Staat Israel sein werden, sondern die konservativen und ultraorthodoxen Gruppierungen innerhalb des Landes. Durch die Zuwanderung von Juden aus Osteuropa, namentlich aus Russland, hat sich Israel stark gewandelt. Politisch ist der 1948 gegründete Staat nach rechts gerückt. Das zeigt auch die Liste und Parteifarbe der Ministerpräsidenten. In der ersten Periode, die fast 30 Jahre dauerte (1948-1977), wurden die Regierungen von linken Parteien angeführt. In der zweiten Periode, die knapp 25 Jahre umfasste (1977-2001), wechselten die Regierungschefs zwischen der Linken und der Rechten, wobei die Rechte doppelt so lang an der Spitze war wie die Linke. In der dritten Periode von 16 Jahren (seit 2001) dominierte nur noch die Rechte:

Vor diesem Hintergrund war der Film absolut legitim, ja bitter nötig. Er bot Einblick in eine Entwicklung und in eine Kultur, die für den Staat Israel eine echte Herausforderung darstellt. Und er erweiterte das Wissen des Publikums. Ich habe den Film mit großem Interesse und mit Gewinn angeschaut und mit Verwunderung vom Gebaren der Ultraorthodoxen Kenntnis genommen. Und ich bewundere gleichzeitig, wie lebhaft die israelische Gesellschaft ihre eigenen Probleme debattiert. Der Film ist ein echtes Stück Aufklärung. Zwar ist die Angabe über die Gesamtzahl der Ultraorthodoxen zu hoch, aber es handelt sich dabei um einen Fehler in einem Nebenpunkt, der nicht geeignet ist, die Meinungsbildung des Publikums zu beeinträchtigen. Eine Richtigstellung ist deshalb nicht nötig. Ich kann insgesamt keinerlei Verstoß gegen das Radio- und Fernsehgesetz erkennen und sehe deshalb auch keinen Grund, Ihre Beanstandung zu unterstützen.
D. Diese Stellungnahme ist mein Schlussbericht gemäß Art. 93 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) orientiert die beigelegte Rechtsbelehrung. Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
[1] Bei „Israel und die Ultraorthodoxen“ handelt es sich um einen Film der Autorin Bethsabée Zarka, produziert von der französischen Filmproduktionsfirma CAPA in Zusammenarbeit mit Canal+. Die Redaktion «DOK» hat den Film eingekauft, bearbeitet und am 31. Mai 2017 ausgestrahlt. Aus rechtlichen Gründen sind Einkäufe nach 30 Tagen nicht mehr auf dem SRF Player zu sehen. Deshalb kann hier kein Link zum Film gegeben werden.
[2] http://gra.ch/bildung/gra-glossar/begriffe/judentum/orthodox-utraorthodox/
[3] https://www.nzz.ch/international/kompromisslose-mission-israels-expansive-ultraorthodoxe-ld.143344; http://www.br.de/nachrichten/elizer-menachem-moses-100.html
[4] http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Issues/Pages/Facts-and-Figures-Islam-in-Israel.aspx
[5] http://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel
[6] http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/

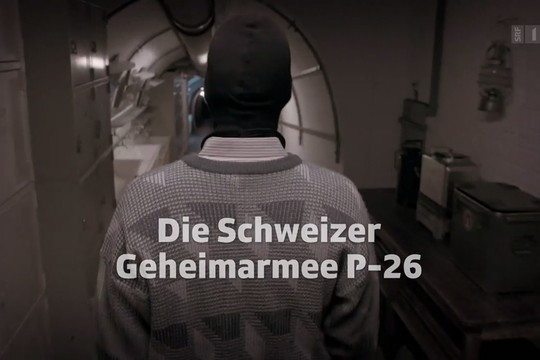

Kommentar