DOK-Film «Die Schweizer Geheimarmee P-26» beanstandet
5425
Mit Ihrem Brief vom 9. April 2018, den Sie irrtümlich zuerst an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) sandten, beanstandeten Sie den DOK-Film «Die Schweizer Geheimarmee P-26», den Fernsehen SRF am 21. März 2018 ausgestrahlt hatte.[1] Ihre Eingabe entspricht den formalen Anforderungen an eine Beanstandung. Ich kann folglich darauf eintreten.
A. Sie begründeten Ihre Beanstandung wie folgt:
«Die untenstehende Beanstandung mache ich im Auftrag des Vorstandes der durch die P-26 betroffenen Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA).
Am 21. März 2018 hat das Schweizer Fernsehen den Film ‘Die Schweizer Geheimarmee P-26’ ausgestrahlt. Obwohl bereits dessen Ausstrahlung im RTS am 21. Dezember 2017 zu Protesten, Reklamationen und Kritiken geführt hatte und obwohl beispielsweise vom Schreibenden gegenüber SRF gefordert worden war, im Falle einer Ausstrahlung diese in einen Rahmen einzubetten, in dem auch KritikerInnen, u.a. Mitglieder der PUK EMD, zu Wort kommen, wurde er in seiner vollen Einseitigkeit und Unsachlichkeit sowie in seiner ganzen Fragwürdigkeit ausgestrahlt. Der einzige Unterschied zur Version ‘L’armée secrète P-26’ war der Verzicht auf Einleitung und Schluss mit ihrer expliziten Rehabilitierung und Positiv-Würdigung der P-26-Mitglieder. Allein: Das Weggelassene widersprach überhaupt nicht dem Film, es machte dessen Einseitigkeit, Unsachlichkeit und Respektlosigkeit gegenüber Parlament und Verfassung besonders deutlich.
Artikel 4 Absatz 4 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) hält fest: <Konzessionierte Programme müssen in der Gesamtheit ihrer redaktionellen Sendungen die Vielfalt der Ereignisse und Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen.>
Diese Bestimmung wird auf schwerwiegendste und eklatanteste Art verletzt. Es kommt ausschliesslich die Pro-P-26-Seite zu Wort:
- Georges Held (P-26-Mitglied)
- Walter Baumann (P-26-Mitglied)
- Adalbert Hofmann (P-26-Mitglied)
- Jean Philipp Aeschlimann (P-26-Mitglied)
- Suzanne Günter (P-26-Mitglied)
- Jacques-Simon Eggly (vom Generalstabschef berufener ‘Beirat’)
- ‘Germain’ (P-26-Mitglied)
- Jacques Baud (Schweizer Militärattaché bei der Nato, die in Sachen ‘stay behind’ schwer belastet ist)
- Pierre Cornu (Autor der ‘Administrativuntersuchung zur Abklärung der Natur von allfälligen Beziehungen zwischen der Organisation P-26 und analogen Organisationen im Ausland’, dessen Auftritt besonders fragwürdig ist, weil sein Bericht geheim ist – bis 2041)
- Martin Matter, Autor des Rehabilitierungs-Werkes ‘P-26. Die Geheimarmee, die keine war. Wie Politik und Medien die Vorbereitung des Widerstandes skandalisierten’
- Titus Meier, Militärhistoriker, Major, dessen Liz-Arbeit und die noch nicht publizierte Dissertation offensichtlich dieselben Absichten verfolgen wie das Matter-Buch.
Obwohl der Bericht der PUK-EMD im Film mit starken Vorwürfen eingedeckt wird, kommt keines deren Mitglieder zu Wort. Es kommt auch keine vom P-26-Szenario ‘Innerer Umsturz’, ‘Unterwanderung und/oder dergleichen’ potenziell betroffene Person (PUK EMD, S. 191) zu Wort. (Wer dazu in Frage kommt, lässt sich nachlesen im Zivilverteidigungsbuch von 1969, dessen Hauptautor gleichzeitig zu den Vorvätern der P-26 gehört.)
Artikel 4, Absatz 2 RTVG hält fest: ‘Redaktionelle Sendungen mit Informationsgehalt müssen Tatsachen und Ereignisse sachgerecht darstellen, so dass sich das Publikum eine eigene Meinung bilden kann.’
Auch diese Bestimmung wird schwerwiegend, zum Teil grotesk verletzt.
Die Darstellung der Bedrohung aus dem Osten durch die P-26-Mitglieder (zB. 4. Minute) wird stehen gelassen, obwohl die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse (z.B. Fuhrer/Wild Band XI der Reihe ‘Der Schweizerische Generalstab’, Baden 2010) sie Lügen strafen und man schon viel früher wusste, dass ihre Wahrnehmung falsch gewesen ist.
Die Aussage <Niemand denkt daran, dem nationalen Verteidigungsbudget Schranken zu setzen> (5. M.), ist schlicht und einfach falsch. Siehe u.a. Chevalier-Initiativen in 50er Jahren / Anti-Atom-Initiativen, Ostermärsche und jurassische Proteste gegen Waffenplatz in 60er Jahren / 49.7 Prozent Ja zu Kriegsmaterialexportverbot 1971, Soldaten- und Kasernenkomitees in 70er Jahren / mehr als 10‘000 verurteilte Militärverweigerer zwischen 1970 und 1990 / Initiativen für Zivildienst und Rüstungsreferendum, Rothenthurm-Initiative, Friedenskundgebungen und GSoA in 80er Jahren usw.! Die Leugnung des Dissenses passt auffällig zur Verharmlosung des Szenarios ‘Umsturz’ samt ‘Unterwanderung’.
Die diesbezügliche Schlüsselaussage der PUK-EMD wird erstens höchst verkürzt dargestellt und zweitens dementiert (35.-37., 44.-46. Minuten), wobei die Dementi kommentarlos und damit affirmativ stehen gelassen werden: <Mit dem ‚Umsturz durch Unterwanderung‘ wird eine Einsatzmöglichkeit definiert, die unter demokratischen Gesichtspunkten nicht annehmbar ist. Dieses Szenario schliesst nicht aus, dass die Organisation auch bei einem in demokratischen Formen zustande gekommenen Machtwechsel eingesetzt werden könnte. Nach Meinung der PUK EMD, die vom Bundesrat geteilt wird, kann es in einer Demokratie nicht Aufgabe der Führung einer Widerstandsorganisation sein zu beurteilen, ob ein politischer Machtwechsel auf Unterwanderung beruht und daher mit den Mitteln des Widerstandes rückgängig zu machen ist - oder ob ein solcher Machtwechsel das Ergebnis einer freien und durch keine Unterwanderung verfälschten Meinungsbildung der Mehrheit darstellt - und daher zu akzeptieren ist.> (S. 192)
(Im redaktionellen Text über den Film erwähnt Hansjürg Zumstein das hochbrisante Kapitel ‘Umsturz’ in keinem Wort. Offenbar ist die (unkorrekte) Botschaft des Films in der Redaktion angekommen.[2]
Der Fall Alboth wird in keinem Wort erwähnt. Herbert Alboth war ein führendes Mitglied der P-26 gewesen. Kurz nachdem diese aufgeflogen war und er offenbar gesagt hatte, er wolle das ganze Material über die Geheimorganisation dem EMD-Chef Kaspar Villiger übergeben, ist er zu Tode gekommen.
Unerwähnt bleibt (abgesehen von einer kleinen Einblendung (48. M) auch die P-27 (was die Tarnbezeichnung für den ausserordentlichen Nachrichtendienst der Schweiz war und Ende 1990 aufgelöst wurde).
Besonders krass ist der Umgang mit der wohl interessantesten Szene des ganzen Films – in dessen Minute 33: Am 7. Dezember 1990, sechs Tage vor der Nationalrats-Debatte über die PUK-EMD findet eine Pressekonferenz statt. An dieser wird der bereits enthüllte Chef der P-26, Efrem Cattelan alias ‘Rico’, der Öffentlichkeit vorgestellt. Rechts von ‘Rico’ sitzen der Generalstabschef Heinz Häsler, dessen Vorgänger Hans Senn und der ehemalige UNA-Chef Richard Ochsner. In der fraglichen Szene sieht man, wie ein Herr, der durch den Film nicht vorgestellt wird, ‘Rico’ den Stuhl hinschiebt und sich dann links von ihm hinsetzt. Dass der fragliche Herr, Hans-Rudolf Strasser (den nur völlige Insider im Film erkennen), in keinem Wort erwähnt wird, ist völlig unverständlich. Der damalige Informationschef des EMD und des Generalstabs gehörte dem Führungsstab der P-26 an – als Verantwortlicher für Propaganda, beziehungsweise Psychologische Kriegsführung. Allerdings wussten das damals weder die anwesenden Medienschaffenden noch sein Vorgesetzter, Bundesrat Villiger. Als Strasser alias ‘Franz’ vier Tage vom Schweizer Radio enttarnt wurde, wurde er gleich entlassen.
Es gibt zwei Erklärungen für den filmischen Lapsus: Die Filmemacher haben übersehen, um wen es sich bei der Person, die dem P-26-Chef den Stuhl hinrückt, handelt. Dann würde sich die Frage stellen, ob sie genügend Wissen haben, um einen Dokumentarfilm zu machen, der den Ansprüchen von Artikel 4 RTVG gerecht wird. Oder (was noch schwerwiegender wäre): Sie haben das sehr wohl gewusst, dieses brisante Wissen aber unterschlagen, weil es ein sehr bezeichnendes und fragwürdiges Licht auf die P-26 und die Armeeführung wirft. Vor allem, was ihr Verhältnis zur Demokratie, insbesondere zu den zuständigen zivilen Behörden, betrifft.
Diese Szene macht klar (allerdings nur, wenn man Strasser erkennt und über ihn informiert ist), dass die P-26 ein Staat im Staat gewesen ist. Weiter macht sie klar, dass die Öffentlichkeit und die zivilen Behörden auch nach der Veröffentlichung des PUK-EMD-Berichts und nach der Ständeratsdebatte hinters Licht geführt wurden. Aber allein die Abhaltung einer Pressekonferenz durch die Armeeführung und den EMD-Informationschef über die PUK-EMD kurz vor dem Plenum der Volksvertretung verstösst gegen die verfassungsmässige Ordnung. Einer deren wichtigsten Grundsätze ist das Primat der Politik. Wäre eine kritische Bemerkung des Films zur PK zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht gewesen?
Wäre nicht gerade, um solchen kritischen Fragen Platz einzuräumen, eine Einbettung des höchst einseitigen Films in eine Diskussion mit P-26-KritikerInnen, ein Muss gewesen?>
B. Die zuständige Redaktion erhielt Ihre Beanstandung zur Stellungnahme. Herr Daniel Pünter, Bereichsleiter DOK und Reportage, antwortete wie folgt:
«Gerne nehmen wir zur Beanstandung von Herrn X, GSoA-Vorstand und Historiker vom 9. April 2018 zum Dokumentarfilm ‘Die Schweizer Geheimarmee P-26’ i n der Sendung‚DOK ‘ Stellung .
1) Vorwurf ‘Einseitig, unsachlich und fragwürdig’
Die Gruppe GSoA kritisiert den Dokumentarfilm über die Schweizer Geheimarmee P-26 als ‘einseitig, unsachlich und fragwürdig’.
Dazu sei einleitend der Kommentartext gleich zu Beginn des Films (Timecode: 01:45) zitiert. Dort heisst es: <Lange haben diese Männer und Frauen geschwiegen. Heute treten sie aus dem Schatten.> Mit dieser Information wird das Publikum klar und deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass im Film ein Kapitel der Schweizer Geschichte aus der Sicht derjenigen Menschen erzählt wird, die in dieser Geheimarmee mitgewirkt haben. Im Vordergrund steht also die subjektive Sichtweise der P-26-Mitglieder. Sie erzählen, was ihre Motivation war, wie sie ausgebildet wurden und was ihr Tätigkeitsumfeld umfasste. Ihre Aussagen sind ein wichtiger Teil dieses Ausschnitts der Schweizer Geschichte. Ob die Existenz dieser Geheimarmee mit dem heutigen Wissen rückblickend befürwortet oder verurteilt werden soll, spielt im Film eine untergeordnete Rolle. Trotzdem thematisiert der Film die Existenz der Geheimarmee nicht unkritisch. Insbesondere die Unrechtmässigkeit dieser Organisation wird im Film deutlich erwähnt. Und überdies wird im letzten Teil des Films die Gefahr und das Risiko einer solchen Geheimorganisation transparent gemacht: Es ist im Film von Umsturz, keiner politischen Kontrolle und einer eventuellen Verwicklung mit rechtsextremen Organisationen die Rede.
Der Vorwurf, der Bericht sei einseitig gewesen, ist für uns nicht nachvollziehbar, weil der Film bereits zu Beginn deutlich macht, dass hier das subjektive Erleben von direkt Beteiligten im Vordergrund steht. Damit wird deklariert, dass der Film keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und nicht die Zielsetzung verfolgt, eine ausgewogene Berichterstattung zwischen Kritikern und Befürwortern zu sein. Es steht für uns ausser Frage, dass diese subjektiven Erlebnisse der ehemaligen Mitglieder der P-26 auch mit den geltenden Rechtsgrundlagen vereinbar sind. Denn sie sind als solche deklariert und für das Publikum deutlich erkennbar.
Wichtig erscheint uns in diesem Zusammenhang die historische Einbettung des Themas. Die P-26-Mitglieder berufen sich auf die Bedrohungen durch den Kalten Krieg, auf die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei und auf diverse andere damalige bedrohliche Konflikte. Wir wissen heute, dass die USA in jener Zeit den Einsatz von Atombomben in Erwägung zog. Im Dokumentarfilm ‘Fog of War’ erzählt der ehemalige Verteidigungsminister Robert McNamara beispielsweise, wie nahe die Welt an einer Katastrophe vorbei schrammte. Diese Fakten sollten auch dem Verfasser der Beanstandung bekannt sein. Damit wird die subjektive Angst jener Zeitzeugen, die sich im Film äusserten, nachvollziehbar und füglich belegt.
Die Wurzeln der geheimen Widerstandsorganisation P-26 gehen sehr weit zurück. Anfangs des Zweiten Weltkrieges gründeten Schweizer Offiziere einen geheimen Bund, um einen inneren Umsturz zu unternehmen, falls der Bundesrat gegenüber Nazi-Deutschland kapitulieren würde. Damit die subjektiven Aussagen der P-26-Teilnehmer noch besser nachvollzogen werden können, sei hier kurz aus einem Brief eines Teilnehmers des geheimen Bundes vom Oktober 1940 zitiert: <Wenn es uns gelingt, für unsere Idee mutig in den Tod zu gehen – und das dürfen wir hoffen, wenn Gott mit uns ist -, so ist etwas gewonnen. Dann werden von unserem Tode Kräfte ausgehen, denen die Deutschen nichts anhaben können. Sie werden vielleicht unser ganzes Land zerstören und es lange besetzt halten. Einmal aber werden unsere Kinder in Gedanken an uns sich zu befreien wissen (...) Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in Deutschland selber über kurz oder lang der Nationalsozialismus und der totale Staat verschwinden werden.>
So wie dieser Offizier damals bereit war, in den Tod zu gehen, um die Schweiz vor dem Faschismus zu bewahren, waren auch die P-26-Teilnehmer bereit, allenfalls ihr Leben zu opfern, um die Schweiz vor einer möglichen sowjetischen Invasion zu schützen. Genauso wie Robert Grimm im Jahr 1935 seine Genossen davon überzeugte, die Schweizer Armee zu akzeptieren und mit der Waffe in der Hand für die Demokratie zu kämpfen, genauso liessen sich auch die Mitglieder der P-26 überzeugen, dass sie für die Verteidigung der Schweizer Demokratie einstehen würden, wenn sie in Gefahr geraten würde.
Die Beweggründe für diese Überzeugung darzustellen, waren das Ziel dieses Films. Ob an dieser Haltung etwas Ehrenrühriges haftet, sei der Beurteilung des Zuschauers überlassen. Ob diese Beweggründe aus heutiger Sicht nachvollziehbar, fragwürdig oder gar illegal waren? Diese Fragen werden im hinteren Teil des Films thematisiert und analysiert.
Aus diesen Gründen sind wir der Meinung, dass der Dokumentarfilm ‘Die Schweizer Geheimarmee P-26’ weder einseitig noch unsachlich war. Das Publikum ist in der Lage, sich nach dem Film eine eigene Meinung zu bilden.
Was die weiteren Vorwürfe betrifft, so nehmen wir wie folgt Stellung:
2) Vorwurf ‘Ausschliesslich die Pro-P-26-Seite kommt zu Wort’.
Dieser Vorwurf ist in unseren Augen haltlos. Die GSoA listet hierzu beispielsweise die Herren Pierre Cornu, Titus Meier und Martin Matter als Pro-P-26-Befürworter auf. Dies ist in unseren Augen nicht korrekt.
Denn Pierre Cornu untersuchte im Auftrag des Bundesrats Aspekte der P-26. Er hatte also eine amtliche Funktion und fasste im Film seine Rechercheergebnisse zusammen. Titus Meier ist Historiker und nimmt im Film die Rolle eines Beobachters von aussen ein. Er ordnet für das Publikum das Geschehene ein. Ihn als Pro-P-26-Befürworter zu bezeichnen, wird ihm nicht gerecht. Es ist für uns im Übrigen nicht nachvollziehbar, woher X von Titus Meier wissen will, was der Inhalt seiner Dissertation sein wird, bevor diese überhaupt erschienen ist. Martin Matter erklärt im Film, er sei damals, als die P-26 aufgedeckt wurde, ein Gegner der Geheimorganisation gewesen. Er hat sich später als Autor gründlich mit der Organisation auseinandergesetzt. Gerade deshalb sind seine Schlussfolgerungen für das Publikum relevant und interessant. Des Weiteren kommen neben diesen drei Experten im Film auch diverse andere Stimmen zu Wort, die sich kritisch zur P-26 bzw. deren Existenz äussern. Wir sind deshalb der Meinung, dass der Vorwurf, dass im Film nur P-26-Befürworter zu Wort kämen, nicht zutreffend ist.
3) Vorwurf: ‘Mitglieder der PUK EMD kommen nicht zu Wort’
Es ist aus unserer Sicht für die Sachgerechtigkeit und Ausgewogenheit unerheblich, ob die Schlüsselaussage der Untersuchung der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK EMD) in Form eines Interviews oder mittels einer Grafik dargestellt wird. Wichtig ist, dass diese Information im Film enthalten ist und für das Publikum deutlich wahrnehmbar ist.
4) Vorwurf: ‘Der Umsturz-Gedanke wird im Film nicht korrekt dargestellt’
Der Film erwähnt prominent das interne P-26-Dokument, welches von dieser Möglichkeit spricht. Der entsprechende Abschnitt im Film möchten wir hier in transkribierter Form wiedergeben. Die verschiedenen Farben bedeuten jeweils eine andere Sprecherstimme, Originalzitate, O-Töne und Quotes sind in kursiver Schrift gehalten, der Kommentartext in normaler Schrift:
(Timecode 35:10) Aber ein internes Dokument der P26 alarmiert. Es erklärt, unter welchen Umständen die Organisation auch tätig werden könnte. Nämlich (Grafiktafel): <Innere politische Umstürze durch Erpressung, Subversion und / oder andere vergleichbare Aktivitäten.> (35:35) Ein Satz, der zutiefst beunruhigt. (...)
Zudem wird der Chef der Geheimarmee (Archivausschnitt) mit dieser Zielsetzung konfrontiert:
(36: 46 O-Ton Archiv RTS-Journalist) (37:02 Quote Effrem Cattelan): <Wir hatten uns niemals gegen innere Feinde vorbereitet. Wir bereiteten uns auf eine Phase der Besetzung des Landes vor, ganz oder teilweise, durch einen Feind von aussen.>
Wir sind der Meinung, dass der Umsturzgedanke korrekt dargestellt wurde und das Publikum die Möglichkeit hatte, sich ein eigenes Bild über diesen Teilaspekt der P-26 zu bilden.
5) Vorwurf: ‘Der Film berichtet nicht über die Bemühungen, das Verteidigungsbudget zu kürzen’
Der Kommentartext thematisiert, dass sich in der betreffenden Zeit die grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung Kürzungen am Militärbudget in keiner Weise vorstellen konnte. Dass es vereinzelt kleine Gruppen gab, die sich vergeblich darum bemühten, Kürzungen am Budget vorzunehmen, liess der Film unerwähnt. Die generelle Aussage, die der Beanstander anbringt, ist zwar korrekt, aber aus unserer Sicht für den Film nicht relevant, weil die Höhe der Verteidigungsausgaben damals unbestritten war.
6) Vorwurf: ‘Die Schlüsselaussage des Berichts PUK EMD werden erstens verkürzt dargestellt und zweitens dementiert’.
Dieser Vorwurf ist falsch. Die Schlüsselaussage folgt im Anschluss an eine Sequenz von Archivaufnahmen aus dem Nationalratssaal. Die Originalstelle im Film lautet in transkribierter Form folgendermassen:
(Timecode: 42:49) Dezember 1990. Der Bericht der Untersuchungskommission wird veröffentlicht. Er verursacht eine Marathon-Debatte im Parlament, zwei Tage lang wird diskutiert. (43:05 O-Ton-Archiv Geneviève Aubry FDP/BE 13.12.1990) <Die Schweiz ist heute benebelt, das Armeekader entmutigt, das Land destabilisiert. Gute Arbeit!> (43:15 O-Ton Archiv Pascal Couchepin FDP/VS 13.12.1990) <Wir richten uns an diejenigen, die mit Patriotismus in diesen Organisationen gearbeitet haben, um ihnen zu sagen, dass wir sie unterstützen. Wir sind nicht damit einverstanden, sie Leuten zum Frass vorzuwerfen, die nicht so viel patriotische Gefühle haben wie sie.> (43:30 O-Ton Archiv Francois Borel SP/NE 13.12.1990) <Gibt es einen Chef im Militärdepartement? Manche sagen ja, aber das ist sicher nicht der Bundesrat. Bei allem Respekt für die demokratischen Institutionen: ich leide, wenn ich sehe, wie der Chef des Militärdepartements von seinen Mitarbeitern übers Ohr gehauen wird.> (43:58 Quote Jacques-Simon Eggly Ex-Parlamentarier) <Da sass Villiger auf der Regierungsbank und ich sagte zu ihm: Herr Bundesrat, wir bezeichnen das als einen Skandal, weil die P26 vielleicht auf einer etwas klareren Rechtsgrundlage hätte beruhen müssen. Vielleicht hätten Sie als Verteidigungsminister besser auf dem Laufenden sein müssen. Vielleicht war das auf zu leichtfertige Weise organsiert, was die rechtliche Absicherung betrifft. Weil vielleicht an dem Punkt, wo wir am Ende des Kalten Krieges standen, die Rechtmässigkeit und sogar die Rechtfertigung hätten diskutiert werden können. (44:27) Aber schliesslich sind diejenigen, die jetzt beschuldigt werden, die Sie beschuldigen lassen, das sind Leute, die sich einsetzten, die bereit waren, unsere Heimat, unser Territorium, unsere Demokratie, unsere Werte zu verteidigen, bis zur Opferung ihres Lebens. Also mehr als andere. Sie waren mehr als nur einfache Staatsbürger.> (44:51) Der Untersuchungsausschuss anerkennt, dass die P26-Mitglieder keine – Zitat – ‘staatsgefährdenden Absichten’ hatten, fällt aber ein strenges Gesamturteil: <Eine geheime, mit Waffen und Sprengstoff ausgerüstete Organisation stellt (...) an sich eine potentielle Gefahr für die verfassungsmässige Ordnung dar, wenn sie von den verfassungsmässigen politischen Behörden nicht auch faktisch beherrscht wird.>
Letztere Stelle ist das Schlüsselzitat des Berichts und wird in voller Länge zitiert. Das kritische Urteil bezüglich Verfassungsmässigkeit der Organisation wird prominent und klar hervorgehoben und eingebettet. Auf die kritische Stimmung in der Politik im Zusammenhang mit der Geheimarmee P-26 wird im Film deutlich hingewiesen. Ausgelassen wurde im Zitattext lediglich die Aussage, dass die PUK EMD den P-26-Mitgliedern ‘keine staatsgefährdenden Absichten’ unterstellte. Diese Information wurde im Kommentartext wiedergegeben (siehe oben).
Wir können den Vorwurf nicht nachvollziehen, dass der Film die Schlüsselstelle nicht vollständig zitiert habe. Auch nicht, dass der Film die Hauptinformation der Schlüsselstelle gleich wieder dementiert habe. Denn die Aussage von Jacques-Simon Eggly im Anschluss an das Schlüsselzitat (45:24) ist kein Dementi des PUK-Berichts, sondern eine subjektive Beurteilung. Herr Eggly räumt sogar ein, dass die Struktur der Organisation aus seiner Sicht ‘mehr politische Absicherungen’ verlangt hätte.
7) Vorwurf: ‘Der Fall Alboth ist im Film nicht erwähnt’.
Dies ist korrekt. Es gibt keinen relevanten bzw. zwingenden Grund, im Dokumentarfilm auf den Fall Alboth näher einzugehen. Herbert Alboth war – im Gegensatz zur Behauptung von X – nicht Mitglied der P-26, sondern Mitglied des Spezialdienstes der ‘Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr’ (UNA). Es handelt sich um eine Vorgängerorganisation der P-26. Die PUK EMD untersuchte das Tötungsdelikt detailliert. Das Fazit lautete: <Die aufgefundenen geheimen Unterlagen, für die die unbekannte Täterschaft keinerlei Interesse gezeigt hatte, sowie weitere Tatumstände sprechen gegen die Annahme eines Zusammenhanges zwischen der Tat und der ehemaligen Tätigkeit des Opfers. Die Untersuchungsbehörde vermutet ein Beziehungsdelikt> (PUK EMD, S. 181/2.) Bei den erwähnten Unterlagen handelt es sich um verschiedene Dokumente rund um die UNA, die Herbert Alboth eigentlich nicht hätte besitzen sollen. Sie wurden nach dem Mord in seiner Wohnung aufgefunden, also nicht gestohlen. Dies war für die Behörden Grundlage für ihre Annahme, der Mord hätte nichts mit seine UNA-Tätigkeit zu tun. Wir sind überzeugt, dass der Fall Alboth keinen relevanten Zusammenhang mit dem im Film behandelten Thema hatte. Das Weglassen des Falls ist gerechtfertigt.
8) Vorwurf: ‘Die P-27 ist nicht erwähnt worden’
Die P-27 hatte nichts mit der P-26 zu tun. Die Organisation P-27 hatte eine rein nachrichten-dienstliche Funktion. Sie war als Folge der Affäre Bachmann organisatorisch strikte von der Widerstandsorganisation P-26 getrennt. Es gab deshalb auch keinen Grund, im Film die P-27 zu erwähnen.
9) Vorwurf: ‘Ein besonders krasser Umgang mit der wohl interessantesten Szene des ganzen Films’
Dieser Vorwurf des Beanstanders hat unserer Meinung einen sehr subjektiven Charakter. Der Film hatte in diesem Abschnitt zum Ziel, die Enttarnung des Chefs der Geheimorganisation zu dokumentieren. Der Filmkommentar und das Originalzitat von Efrem Cattelan (Schrift in kursiv und rot) lautet:
(Timecode 33:20) Dann enthüllt die Presse die Identität des obersten Chefs der P26: Efrem Cattelan, Codename: Rico. In einer Pressekonferenz spricht Efrem Cattelan zum ersten Mal vor der Nation (33:42): <Dem habe ich mich mit Überzeugung gestellt, wie wohl ich wissen musste, dass das verbundene – in Anführungszeichen – ‘Doppel-Leben’ mich psychisch belasten würde. Das heisst, ich musste vor meinen Eltern und Verwandten meine berufliche Tätigkeit verschweigen. Eine oft belastende Lage.> (33:57) Rico tarnte seine wirkliche Tätigkeit unter dem Deckmantel einer fiktiven Beratungsfirma mit Sitz in Basel, für ein Jahresgehalt von 180 000 Franken, das man diskret aus dem Fonds der Armee abzweigte.
Es ist unserer Meinung nach für das Publikum nicht wichtig zu wissen, ob an der Pressekonferenz noch weitere Mitglieder der P-26 sassen. Relevant für das Publikum ist in unseren Augen, dass es erfährt, wie Efrem Cattelan seine Tätigkeit für die Organisation damals raffiniert tarnte.
Dass die P-26 ein Staat im Staat gewesen sei, ist eine Beurteilung von Herrn X. Korrekt ist, dass die P-26 nie eine rechtmässige Grundlage hatte. Diese Tatsache kommt im Film deutlich zum Ausdruck. Hierzu seien die Ausführungen des alt Nationalrats Jacques-Simon Eggly im Film noch ein zweites Mal zitiert:
<Da sass Villiger auf der Regierungsbank und ich sagte zu ihm: Herr Bundesrat, wir bezeichnen das als einen Skandal, weil die P26 vielleicht auf einer etwas klareren Rechtsgrundlage hätte beruhen müssen. Vielleicht hätten Sie als Verteidigungsminister besser auf dem Laufenden sein müssen. Vielleicht war das auf zu leichtfertige Weise organsiert, was die rechtliche Absicherung betrifft. Weil vielleicht an dem Punkt, wo wir am Ende des Kalten Krieges standen, die Rechtmässigkeit und sogar die Rechtfertigung hätten diskutiert werden können.>
Wir sind der Meinung, dass die Fakten sachlich korrekt widergegeben wurden und sich das Publikum ein eigenes Urteil bilden konnte.
Fazit:
Wir wollen abschliessend nochmals darauf hinweisen, dass der Film in erster Linie ein Zeugnis von ehemaligen Mitgliedern der P-26 war und dies für das Publikum transparent deklariert wurde. Es sind subjektive Aussagen von unmittelbaren Zeitzeugen, die sich bisher noch nie öffentlich über ihre ‘geheime’ Vergangenheit äusserten. Das Publikum erhält dadurch einen neuen und ergänzenden Einblick in ein Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte - einen unmittelbaren in die Motivation der P-26-Mitglieder, in die Art und Weise, wie sich diese Menschen für ihre Funktion in der Geheimarmee ausbildeten und wie sie damals die Umstände und das Zeitgeschehen wahrnahmen. Ob die Geheimorganisation P-26 eine gute Idee war oder nicht, ob sie damals nötig war oder nicht – darüber kann sich das Publikum am Schluss des Filmes trotz der vielen Aussagen von ehemaligen Mitgliedern der P-26 eine eigene Meinung bilden. Im Film wurde deklariert, dass die Organisation zu keinem Zeitpunkt rechtmässig war und eine politische Kontrolle fehlte.»
C. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Ich kann Ihre Perplexität sehr gut verstehen, denn der DOK-Film setzte gegenüber der bisherigen Wahrnehmung der P-26 in einen völlig neuen Ton. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Begründungskontext und dem Wirkungskontext. Von diesen beiden Kontexten muss zunächst die Rede sein.
Der Begründungskontext von Geheimarmeen oder geheimen Widerstandsorganisationen in westlichen Ländern und damit auch in der Schweiz stützte sich auf die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch auf die Gefahren, die aus dem «Kalten Krieg» abgeleitet wurden. Praktisch alle NATO-Länder stellten Geheimarmeen auf.[3] Im Falle des neutralen Kleinstaates ging es darum zu überlegen, was im Falle einer Besetzung der Schweiz zu tun wäre.
Mit Bewunderung blickte man auf die Widerstandsbewegungen zurück, die sich während der nationalsozialistischen Besetzung oder der faschistischen Herrschaft namentlich in Frankreich, in Italien oder in Jugoslawien organisiert hatten. Auch in der Schweiz traf damals eine kleine Gruppe von Offizieren Vorbereitungen für den Fall der Besetzung durch Deutschland und der Kapitulation des Bundesrates und der Armeespitze: Diesem am 21. Juli 1940 gegründeten Offiziersbund[4] gehörten namentlich Dr. Alfred Ernst (1904-1973, später Korpskommandant und Dozent für Militärgeschichte)[5], Hans Hausammann (1897-1974, Fotograf, Leiter des Nachrichtendienstes «Büro Ha»)[6], Dr. Max Waibel (1901-1971, Generalstabsoffizier)[7], Dr. August Lindt (1905-2000, Bankangestellter, Journalist)[8] und Dr. Walter Allgöwer (1912-1980, Journalist, später Nationalrat)[9] an. Er schwor sich, den Widerstand, komme, was da wolle, auf jeden Fall fortzusetzen. Die Sache kam indes aus, die Mitglieder des Offiziersbundes wurden verhaftet, aber nur disziplinarisch bestraft. General Henri Guisan tadelte das Vorgehen, aber lobte die Motive der Verschwörer.
In der Nachkriegszeit ging man von der Aggressivität der Sowjetunion aus und befürchtete jederzeit den Einmarsch der Roten Armee. Dass die Sowjetunion Befreiungsbewegungen unterstützte und in Korea, in Vietnam, in Arabien, in Afrika und in Lateinamerika Umstürze und antikoloniale Kriege mittrug, war bekannt. Aber die Angst vor der «roten Gefahr» war in Westeuropa wohl eher übertrieben. Dass Stalin Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien und die spätere DDR und ein Stück weit auch Jugoslawien unter sowjetische Kontrolle brachte, war eine Folge von Hitlers Angriffskriegen. Für den Rest Europas und für Nordamerika galt hingegen weitgehend das Prinzip der «friedlichen Koexistenz», das vor allem Chruschtschow betonte. Die Interventionen der Sowjettruppen in der DDR (1953), in Ungarn (1956) und in der Tschechoslowakei (1968) waren Interventionen innerhalb des kommunistischen Bündnissystems, so brutal sie auch ausfielen. In der Schweiz wollte man aber gewappnet sein. Und die Idee war, dass man den geheimen Widerstand unter Einschluss der Zivilbevölkerung vorbereiten müsse.
Dem widersprach Bundesrat Paul Chaudet (FDP), der damalige Militärminister, am 25. September 1957 vor dem Nationalrat deutlich, als er sagte: «Ein ‘geheimer’ Widerstandskampf kann definitionsgemäss nicht vorbereitet werden. (...) Die Wirksamkeit eines Systems für den geheimen Widerstand beruht auf der absoluten Geheimhaltung. (...) Eine in Friedenszeiten vorbereitete Organisation läuft Gefahr, bei der Besetzung sofort zerschlagen zu werden. – Eine – vielleicht erstaunliche – Erfahrung zeigt, dass es nicht möglich ist, von vorneherein zu bestimmen, wer sich für die ganz besondere Aufgabe des geheimen Widerstandes eignet. Es ist erstaunlich, wie Leute, deren Mut zuvor nicht besonders aufgefallen ist, oft auch Frauen und Minderjährige, eine grösste Risikobereitschaft gezeigt und schwere Verantwortung übernommen haben, während andere, anscheinend für Heldentaten vorbereitet, sich der brutalen Drohung der Besetzungsmacht beugten – eine Drohung, die oft gegen die Familienangehörigen gerichtet war. (...).»[10]
Trotzdem gab Generalstabschef de Montmollin in der Folge den Auftrag, eine Widerstandsorganisation mit Schwergewicht auf dem Nachrichtendienst zu bilden. 1965/66 entstand in der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA) ein «Spezialdienst», der 1973 den Auftrag erhielt, «Nachrichten über Gegner und Umwelt (im feindbesetzten Gebiet)» zu beschaffen, «moralischen und passiven Widerstand der Bevölkerung» aufrechtzuerhalten und «beschränkte Sabotageakte und Attentate» durchzuführen, und der aus einem Armeestabsteil, Vertrauensleuten in der ganzen Schweiz und der eigentlichen Widerstandsorganisation bestand.[11] Die Gesamtbevölkerung versuchte man 1969 mit dem umstrittenen «Zivilverteidigungsbüchlein» einzubeziehen.[12] Im Bericht über die Sicherheitspolitik von 1973, den das Parlament zur Kenntnis nahm, wurde die Notwendigkeit des Widerstandes im Falle einer Besetzung der Schweiz erwähnt. Das Parlament erfuhr aber nicht, dass dieser Widerstand bereits vorbereitet wurde.[13] 1981 erließ der Generalstabschef im Einvernehmen mit Bundesrat Georges-André Chevallaz (FDP) ein Grundlagendokument zur Vorbereitung des Widerstandes: die Schaffung der Organisation Projekt 26 (P-26). Davon erfuhr aber das Parlament nichts. Die «rote Gefahr» diente als Begründung für eine heimlich etablierte, ausreichend bewaffnete, rechtlich nicht abgestützte, intransparent finanzierte und parlamentarisch nicht kontrollierte Widerstandsorganisation aus Armeeangehörigen, aber außerhalb der eigentlichen Armee.
Der Wirkungskontext hatte mit der Fichen-Affäre zu tun. Nach dem Rücktritt von Bundesrätin Elisabeth Kopp (1988/89) untersuchte eine Parlamentarische Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Nationalrat Moritz Leuenberger (SP, Zürich) die Zustände im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Dabei stieß sie auf die systematische Bespitzelung innenpolitischer Kritiker und Oppositioneller durch die politische Polizei mit Hilfe Hunderttausender von Fichen. Dieser Fichen-Skandal führte direkt oder indirekt dazu, dass auch eine Parlamentarische Untersuchungskommission für das Eidgenössische Militärdepartement unter dem Vorsitz von Ständerat Carlo Schmid (CVP, Appenzell Innerrhoden) eingesetzt wurde. Die Verbindung zur Fichenaffäre war die dann entdeckte militärische Verdächtigenliste: 1950 war vereinbart worden, dass in Kriegszeiten «die Kategorie der ‘gefährlichen’ Extremisten möglichst noch vor der Kriegsmobilmachung verhaftet und den Territorialdiensten zur Bewachung übergeben werden» sollte.[14] In den sechziger Jahren führte man Listen mit 450-850 verdächtigen Armeeangehörigen.[15]
Dass die Parlamentarische Untersuchungskommission dann auch die P-26 entdeckte und dass die Medien darauf deren Chef enttarnten, trug zur Aufgeregtheit bei. Aber die P-26 und die Fichierten hatten miteinander nichts zu tun: Bei den Fichierten ging es um einheimische (inländische oder ausländische) «Unzuverlässige», bei den Feinden der P-26 aber um potenzielle Besetzer der Schweiz, also um eine ausländische Armee und um die ihr nachrückenden fremden Polizei- und Verwaltungskräfte. Es gab eine einzige Verbindung: Der im Konzept der P-26 erwähnte «Umsturz durch Unterwanderung», gegen den ebenfalls Widerstand zu leisten sei. Hier hätte sich die P-26 auch gegen innenpolitische Veränderungen gewandt, und dies kritisierte die Parlamentarische Untersuchungskommission scharf: Das sei unter demokratischen Gesichtspunkten nicht annehmbar, weil dies nicht ausschließe, dass die Widerstandsorganisation auch bei einem Machtwechsel eingesetzt werden könnte, der demokratisch zustande kommt.[16] Will sagen: Wenn der Schweizer Souverän in Wahlen beispielsweise entschieden hätte, dass Kommunisten und Sozialdemokraten die Mehrheit der Sitze erlangen und damit eine Art «Volksfront»-Bundesrat bilden können, dann wäre die P-26 nicht legitimiert gewesen, dagegen einzuschreiten, weil bewaffneter Widerstand gegen den Willen des Volkes dem demokratischen Prinzip widerspricht.
Zusammengefasst: Der Begründungskontext macht plausibel, dass man in der Schweiz für den Fall einer ausländischen Besetzung des Landes gewappnet sein wollte. Der Wirkungskontext liess hingegen die Enthüllung einer rechtlich nicht legitimierten militärischen Geheimorganisation als Skandal erscheinen. Die Parlamentarische Untersuchungskommission hat denn auch massiv Kritik an der P-26 geübt: an der unzulässigen Finanzierung ohne gesetzliche Grundlage[17], an der Sonderstellung neben der Armee und an der Übertragung hoheitlicher Kompetenzen an Private.[18] Die Aufsicht der politischen Behörde habe gefehlt. Die Verteidigungsminister nach Chevallaz, nämlich Jean-Pascal Delamuraz (FDP, 1983-1986), Arnold Koller (CVP, 1986-1989) und Kaspar Villiger (FDP, ab 1989) wussten nur vage oder gar nicht Bescheid, weil die Generalstabschefs sie ungenügend informierten. Und die Untersuchungskommission schrieb: «Die Gefahr eines Missbrauchs durch Selbstaktivierung besteht. Sie erhöht sich wegen des klandestinen Aufbaus von P-26».[19] Ferner: «Die Übertragung einer derart wichtigen Staatsaufgabe auf eine geheimgehaltene Organisation lässt sich mit einer demokratisch aufgebauten Rechtsgemeinschaft nicht vereinbaren. (...). Die Möglichkeit, dass die Mitglieder einer solchen auf Kooptation gegründeten Gesellschaft gegebenenfalls auch gegen einen Entscheid der Behörden handeln können, besteht.»[20]
Und nun komme ich zum ausgestrahlten DOK-Film. Es ist absolut zulässig, einen solchen Film anwaltschaftlich aus der Perspektive der ehemaligen P-26-Angehörigen zu gestalten. Die Tatsache, dass die Mitglieder der P-26 erst vor kurzem von ihrer Schweigepflicht entbunden wurden, lud geradezu dazu ein.[21] Natürlich muss die Gegenposition auch zum Ausdruck kommen, aber es ist nicht verlangt, dass sie gleichgewichtig vertreten ist, und es ist auch nicht verlangt, dass dann, wenn die P-26-Angehörigen in Interviews zum Zuge kommen, auch ihre Kritiker in Interviews zum Zuge kommen müssen. Das Vielfaltsgebot und damit die Idee einer gewissen Ausgewogenheit gilt außerhalb von Wahlen und Abstimmungen nicht für jede einzelne Sendung, sondern für das Programm im zeitlichen Längsschnitt insgesamt. Es genügt, wenn die Gegenposition dokumentiert wird, und das ist in dem Film der Fall.
Gleichwohl habe ich mich gewundert, dass kein einziges Mitglied der Parlamentarischen Untersuchungskommission befragt wurde. Von den zehn Mitgliedern sind zwar drei inzwischen gestorben, nämlich die Ständeräte Robert Ducret (1927-2017, FDP, Genf, Kohlenhändler, 1983-1991 im Rat)[22] und Dr. André Gautier (1924-2000, liberal, Genf, Arzt, 1987-1991 im Rat)[23] sowie Nationalrat Max Dünki (1932-2011, EVP, Zürich, Gemeindeschreiber, 1983-1999 im Rat)[24]. Aber die andern sind noch da, und einzelne hätten sich äußern können, sicher Carlo Schmid, Präsident der PUK (68, CVP, Appenzell Innerrhoden, Notar, Ständerat 1980-2007)[25], vielleicht auch Werner Carobbio, Vizepräsident der PUK (82, SP, Tessin, Unternehmensberater, Nationalrat 1975-1999)[26], Esther Bührer (92, SP, Schaffhausen, Lehrerin, Ständerätin 1979-1991)[27], Bernhard Seiler (88, SVP, Schaffhausen, Direktor einer Landwirtschaftsschule, Ständerat 1987-1999)[28] , Dr. Anton Keller (84, CVP, Aargau, Gymnasiallehrer, Nationalrat 1979-1995)[29], Dr. Willy Loretan (84, FDP, Aargau, Stadtammann, Nationalrat 1979-1991 und Ständerat 1991-1999)[30] oder Hanspeter Thür (69, Grüne, Aargau, Anwalt/Datenschützer, Nationalrat 1987-1999)[31].
Allerdings: Wie die Redaktion (bzw. ein Filmemacher) ein Thema angeht, wer befragt wird, welcher Dramaturgie der Film folgt, das liegt in der Programmautonomie des Senders. Das Radio- und Fernsehgesetz billigt sie den Programmschaffenden ausdrücklich zu, denn es gehört zur Medienfreiheit, dass kein Gesetz, kein Parlament, kein Gericht, kein Ombudsmann den Medien vorschreibt, wie sie von der Freiheit Gebrauch machen. Und im Rahmen der Programmautonomie ist es auch vollkommen zulässig, den Fall Aboth wegzulassen, die P-27 nicht zu erwähnen und den Fall Strasser nicht zu thematisieren. Der Film mag einen anwaltschaftlichen Touch gehabt haben, er mag einen etwas überraschenden Ton gesetzt haben, er mag die sich durchziehende Kritik an der Armee und an der Rüstung unterbelichtet haben: Er hat indes die wesentlichen Fakten zur P-26 enthalten. Insofern hat er das Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt. Und aus diesem Grund kann ich Ihre Beanstandung nicht unterstützen.
D. Diese Stellungnahme ist mein Schlussbericht gemäß Art. 93 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) orientiert die beigelegte Rechtsbelehrung. Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
[1] https://www.srf.ch/sendungen/dok/die-schweizer-geheimarmee-p-26
[2] https://www.srf.ch/sendungen/dok/unterwegs-als-geheimsoldat-in-der-schweiz
[3] Sie hat Daniele Ganser in seiner Dissertation umfassend untersucht: Daniele Ganser (2008): NATO-Geheimarmeen in Europa. Inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung. Zürich: Orell Füssli.
[4] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D30549.php
[5] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23767.php
[6] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23767.php
[7] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24381.php
[8] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D14864.php
[9] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6158.php
[10] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 178.
[11] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 179-180.
[12] Albert Bachmann/Georges Grosjean (1969): Zivilverteidigung. Bern: EJPD, http://www.libenter.ch/090610_zivilverteidigung_1969_v1.4_de.pdf
[13] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 183.
[14] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 144 ff.
[15] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 148.
[16] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 192.
[17] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 209/10.
[18] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 215-224.
[19] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 200.
[20] https://www.parlament.ch/centers/documents/de/ed-berichte-puk-emd.pdf, S. 204.
[21] Der Journalist Martin Matter hat dies mit seinem Buch ja gewissermaßen eingeläutet: Martin Matter (2012): P-26. Die Geheimarmee, die keine war. Wie Politik und Medien die Vorbereitung des Widerstandes skandalisierten. Baden: hier + jetzt. Auf das Buch folgten dann verschiedene Anerkennungsfeiern für die P-26 in den Kantonen.
[22] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6781.php
[23] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6782.php ; https://www.parlament.ch/de/biografie/andré-gautier/780
[24] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D33674.php
[25] https://www.parlament.ch/de/biografie/carlo-schmid-sutter/195
[26] https://www.parlament.ch/de/biografie/werner-carobbio/39
[27] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D6119.php; https://www.parlament.ch/de/biografie/esther-bührer/778
[28] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D33463.php; https://www.parlament.ch/de/biografie/bernhard-seiler/204
[29] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D33722.php ; https://www.parlament.ch/de/biografie/anton-keller/123
[30] http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D33723.php ; https://www.parlament.ch/de/biografie/willy-loretan/136
[31] https://www.parlament.ch/de/biografie/hanspeter-thür/223
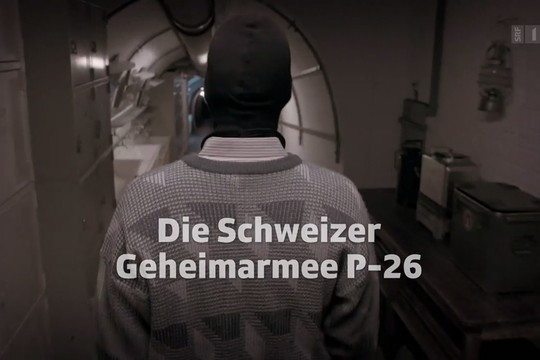

Kommentar