«10vor10»-Beitrag «Rammstein im Stade de Suisse in Bern» beanstandet

6017
Mit Ihrem Brief vom 7. Juni 2019 beanstandeten Sie die Sendung «10 vor 10» (Fernsehen SRF) vom 5. Juni 2019 und dort den Beitrag «Rammstein im Stade de Suisse in Bern.[1] Ihre Eingabe entspricht den formalen Anforderungen an eine Beanstandung. Ich kann daher darauf eintreten. Leider erhalten Sie diesen Schlussbericht arg verspätet. Das hat damit zu tun, dass die Ombudsstelle stark überlastet ist. Ich bitte Sie, die Verspätung zu entschuldigen.
A. Sie begründeten Ihre Beanstandung wie folgt:
«Ich bin 91 und sehbehindert sowie komputer Analphabet, kenne aber die Zeit des 2. Weltkrieges als Zeitgenossin. Ich nehme an, dass Sie als gebildete Menschen auch Handschriften lesen können und alte erfahrene Menschen auch ernst nehmen.
Grund der Beschwerde: Ich fühle mich als Jüdin durch die zynische Verwendung von Kostümen aus der Nazizeit persönlich verletzt und beleidigt. Die Gruppe wollte damit für ihre Reklame nur Aufsehen erregen und die sehr lange und ausführliche Sendung hat ihr dabei geholfen. Den Holocaust zu leugnen, ist verboten, aber ihn für seine eigensüchtigen Ziele zu brauchen, zeugt von einer schäbigen Gesinnung, und es ist sicher nicht die Aufgabe eines Schweizer Senders dabei zu helfen.
Sie haben dabei mitgeholfen, das unermessliche Leid zu verharmlosen und tragen damit bei, den wieder aufflammenden Antisemitismus zu entfachen. Mit scheint, eine Entschuldigung wäre fällig (im 10 vor 10).»
B. Die zuständige Redaktion erhielt Ihre Beanstandung zur Stellungnahme. Für «10 vor 10» antworteten Herr Christian Dütschler, Redaktionsleiter, und Frau Corinne Stöckli, Fachspezialistin SRF:
«Frau X beanstandet unseren Bericht über die Band Rammstein, welchen wir in der Sendung 10 vor 10 vom 5. Juni 2019 ausgestrahlt haben.
Anlass für den Bericht war das Konzert der umstrittenen Band Rammstein im Stade de Suisse in Bern, welches am Tag der Sendung stattfand. Als eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands startete Rammstein 2019 zum 25-jährigen Bandjubiläum ihre bis anhin grösste Europatournee – innerhalb weniger Minuten hatte Rammstein dabei über 800'000 Tickets verkauft. Zum Erfolgsrezept von Rammstein gehört die Provokation. In unserem Bericht zeigen wir auf, wie Rammstein auch im Zusammenhang mit dem neusten Album bewusst provoziert, indem sich die Bandmitglieder in der Kleidung von KZ-Insassen mit Strick um den Hals zeigen. Im Zentrum unseres Berichts steht dabei die Frage, ob die Band mit dieser Provokation nun definitiv eine Grenze überschritten hat. Dabei haben wir im Beitrag eine klare Haltung eingenommen und kamen zum Schluss: Ja, die Band hat eine Grenze überschritten, ‘und das ziemlich plump und berechenbar’.
Die Beanstanderin fühlt sich durch <die zynische Verwendung von Kostümen aus der Nazizeit persönlich verletzt und beleidigt>. Sie meint, durch die Berichterstattung hätten wir <mitgeholfen, das unermessliche Leid zu verharmlosen> und würden damit beitragen, <den wieder aufflammenden Antisemitismus zu entfachen.> Gerne nehmen wir zu dieser Kritik Stellung.
Vorab möchten wir aber anmerken, dass die Beanstanderin als Zeitzeugin eine besondere Perspektive hat, die wir auch besonders respektieren wollen. Ihr Schreiben hat uns betroffen gemacht und zum Nachdenken gebracht. Auch wenn wir nach nochmaliger, intensiver Analyse des Beitrages inhaltlich schliesslich anderer Meinung sind und den Beitrag so für vertretbar halten, so möchten wir uns doch in aller Form für die Verletzung der Gefühle der Beanstanderin durch die gezeigten Bilder entschuldigen. Es war in keiner Weise unsere Absicht, jemanden zu verletzen. Unser Ziel war es, die konkrete Grenzüberschreitung und das Konzept dahinter aufzuzeigen und kritisch zu erläutern.
1) Der Hintergrund
Als die Band Rammstein im März 2019 vorgängig zur neuen Single den Teaser zum Song ‘Deutschland’ veröffentlichte, wurde dies sehr breit diskutiert und auch kritisiert. Der Teaser zeigt die Bandmitglieder am Galgen stehend – mit einem Strick um den Hals und in den gestreiften Kleidern von KZ-Häftlingen. Die Auflösung folgte einen Tag später mit der Veröffentlichung des ganzen, insgesamt neun Minuten langen Videoclips. Dieser zeigt, dass es um die deutsche Geschichte insgesamt geht, wobei sich die Bandmitglieder im Video in verschiedenen Rollen inszenieren: Als germanische Kämpfer, Links-Terroristen, sozialistische Funktionäre, SS-Offiziere – und schliesslich eben auch als KZ-Insassen. Sie thematisieren das Dilemma, dass man der Geschichte wegen Deutschland nicht lieben darf – und sagen im Video eindeutig: <Deutschland, meine Liebe kann ich Dir nicht geben> (wird im Beitrag wörtlich so gesagt). Auch wenn der Gesamt-Clip den früheren Teaser relativiert: Die Provokation hat für Aufsehen gesorgt und so eine neue Stufe erreicht. Dieses Thema schien uns interessant und relevant, weshalb wir uns für einen Bericht entschieden haben.
2) Unser BerichtIn unserem Beitrag haben wir aufgezeigt, mit welchem Kalkül die Band den grenzüberschreitenden Teaser publiziert hat und wie dieser im Gesamtkontext zu verstehen ist.
Gleich zu Beginn des Beitrages zeigen wir die umstrittene KZ-Szene und bezeichnen sie umgehend als ‘bewusste Provokation’. Wörtlich hiess es:
Die Bandmitglieder vor ihrer Hinrichtung. Strick um den Hals, Kleidung von KZ-Insassen. So haben Rammstein ihren neusten Song beworben. Eine bewusste Provokation.
Dann wird im Beitrag die Kritik von jüdischer Seite erwähnt. Wörtlich:
Das Video sei beschämend – und nutze den Holocaust für Werbezwecke, sagt etwa das israelische Aussenministerium.
Der Beitrag beleuchtet dann die neue Eskalationsstufe im System Rammstein und ordnet die verwendeten Bilder mit Hilfe eines ausgewiesenen Experten ein: Caspar Battegay, Kulturwissenschaftler der Universität Basel, der sich intensiv mit der Popkultur im Judentum und dem Umgang mit dem Holocaust in der Popkultur auseinandergesetzt hat. Wörtlich:
Hat die Band eine Grenze überschritten? Wir fragen einen, der sich mit der Abbildung des Holocaust in der Popkultur auseinandersetzt. Kulturwissenschaftler Caspar Battegay findet es verwerflich, die KZ-Szene für sich allein zu publizieren, wie dies die Band gemacht hat:
Caspar Battegay, Kulturwissenschaftler Universität Basel:
<Wenn man die Szene als Clip allein anschaut und freistellt, finde ich das ist sehr problematisch. Das ist eine Instrumentalisierung des Geschehenen, des Holocausts, der Opfer – das geht überhaupt nicht, weder politisch noch moralisch. Wenn man es im Kontext vom ganzen Film, von dem Video anschaut, dann ist es etwas anderes.>
Der Beitrag macht also gleich im ersten Teil klar, dass Experten die einzeln gezeigte Szene als verwerflich betrachten und somit auch das Vorgehen der Band verurteilen. Dann wird der Bogen aufgemacht und auf das Gesamtwerk verwiesen:
Denn erst beim Betrachten des Gesamtkunstwerkes wird klar: Die Band reitet quer durch die Deutsche Geschichte. Als germanische Krieger, DDR-Funktionäre, RAF-Terroristen. Sie thematisieren das Dilemma, dass man der Geschichte wegen Deutschland nicht lieben darf – und sagen eindeutig: <Deutschland, meine Liebe kann ich Dir nicht geben.> Und: Germania – die Personifikation Deutschlands – ist eine schwarze Frau.
Caspar Battegay, Kulturwissenschaftler Universität Basel:
<Das provoziert insofern es keine blonde, weisse Frau ist, sondern eine dunkelhäutige. Das zeigt auch, dass es darum geht, eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte zu zeigen. Eine kritische, bei der es um Identität geht, auch um Herausforderung und gewisse Identitätsbilder.>
Darauf zeigt der Beitrag anhand zweier Zitate von Bandmitgliedern auf, wie die Band auch im konkreten Fall mit der Ambivalenz spielt und letztlich Antworten auf kritische Fragen schuldig bleibt.
Im letzten Teil des Beitrages wird das Business-Modell Rammsteins von Dominic Dillier durchleuchtet. Er ist Experte für Rockmusik bei SRF und verfolgt die Band Rammstein seit rund zwei Jahrzehnten. Dillier erklärt im Beitrag, dass Rammstein schon immer Kunst machen wollte, <die aneckt und schockiert>. Es funktioniere immer gleich: <Vor allem die Veröffentlichungsstrategie. Man bürstet es auf Provokation, auf Skandal und erregt so die Aufmerksamkeit>.
Abschliessend hält der Beitrag noch einmal klar fest, dass es sich beim KZ-Teaser um eine Grenzüberschreitung handelt, die gezielt eingesetzt wurde. Wörtlich:
Hat die Band nun wieder eine Grenze überschritten? Ja. Und das ziemlich plump und berechenbar. Aber schon nur der Verdacht, sie seien irgendwelche Faschisten, erhöht ihre Bekanntheit schlagartig.
Der Beitrag hat also inhaltlich konsequent die aktuelle Provokation aufgegriffen und in einen grösseren Zusammenhang gestellt. Dabei haben wir kritische Distanz gewahrt und eine klare Haltung eingenommen.
3) Zur Kritik
Die Beanstanderin ist nun der Meinung, wir hätten durch unsere Berichterstattung <mitgeholfen, das unermessliche Leid zu verharmlosen und tragen damit bei, den wieder aufflammenden Antisemitismus zu entfachen.> Nichts liegt uns ferner als dies. Gerade deshalb haben wir uns bei der Entstehung des Beitrages eingehend Gedanken gemacht und uns kritisch hinterfragt. Wir haben zwei Experten gesprochen und interviewt. Darüber hinaus haben wir zusätzlich ein Hintergrundgespräch mit einem ausgewiesenen Extremismus-Experten geführt. Auf dieser Basis kamen wir zum Schluss, dass es vertretbar ist, die kritisierten Bilder im Kontext des Beitrages so zu zeigen.
Bei der Band Rammstein handelt es sich wie oben dargelegt, nicht etwa um eine unbedeutende Lokalband, der wir über unsere Berichterstattung erst eine Plattform gegeben haben. Wie oben erwähnt hat die Band riesigen Erfolg – eine kritische Berichterstattung über den neusten, grenzüberschreitenden Marketing-Coup dieser Band ist deshalb journalistisch mehr als gerechtfertigt: Wir sehen es gerade als unsere journalistische Aufgabe an, unserem Publikum aufzuzeigen, wie das System Rammstein funktioniert und wie dieses mit den fraglichen KZ-Bildern eine neue Eskalationsstufe erreicht hat.
Über das neue Album von Rammstein wurde breit berichtet, wobei deutschsprachige Leitmedien das Thema an prominenter Stelle aufgegriffen haben. Ausgewählte Beispiele:
NZZ am Sonntag, 19. Mai 2019, aus: Wie man ins Leere provoziert
Die Provokation ist zur leeren Hülle verkommen, die Grenzwertigkeit und die bewusste Widersprüchlichkeit zur Farce. (...) Erstaunlich eigentlich, dass die KZ-Szene im Film zu «Deutschland» überhaupt noch für grossen Gesprächsstoff sorgt.
NZZ, 24. Mai 2019, aus: Wer zündelt, macht Kohle
Wenn Rammstein Realien des Holocaust als Accessoire einer gruseligen Pop-Show missbraucht, müssen diese zu Abziehbildern des Grauens verflachen. Das mag die Empörung all jener erklären, die noch einen emotionalen Bezug zur historischen Realität haben. Aber die inszenierte Tabuverletzung macht die Musiker nicht zu Antisemiten. Eher handelt es sich um Effekthascher, die grobschlächtig die Klaviatur der Zweideutigkeit bedienen.
SonntagsZeitung, 5. Mai 2019, aus: Die Zündler
Und in Zeiten, in denen Nazi-Symbolik längst wieder gegenwärtig geworden ist – ob in Ostdeutschland, in Schwyz, in Charleston –, kann es keine gute Idee sein, mit einem Teaser zu zündeln, in dem sich die Bandmitglieder als KZ-Häftlinge und damit als Opfer inszenieren (eine Szene, die im knapp zehnminütigen Clip-Bildersturm zum neuen Song ‘Deutschland’ aufgelöst wird).
Die Zeit online, 28. März 2019, aus: Kann ich Dich lieben, will Dich hassen (Kommentar)[2]
Und es darf als gesellschaftspolitisches Verdienst gewertet werden, vor dem Hintergrund eines aktuell erstarkenden Nationalismus in nahezu allen Teilen der Welt das letztlich unpopuläre Prinzip der Ironie als künstlerische Haltung einzubringen.
Spiegel online, 29. März 2019, aus: Eine Falle [3]
Interessant, wie differenziert und besonnen eine Sprecherin der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem in Jerusalem auf die Provokation reagierte. Die Erinnerung an den Holocaust dürfe nicht nur als ‘bloßes Werkzeug’ dienen, um ein Produkt zu verkaufen oder, wie in diesem Fall, öffentliches Interesse für ein Video zu wecken. Gleichwohl seien ‘künstlerische Arbeiten, die an Holocaust-Bilder erinnern’, nicht generell zu verurteilen.
Weiter unten meint der Autor des Artikels zudem:
So eindeutig wie hier haben sich Rammstein bisher noch nie vom Nationalismus distanziert.
Die Haltungen der verschiedenen Medien unterscheiden sich also beträchtlich. Einig sind sich die etablierten Medien aber darin, dass das Thema relevant und berichtenswert ist.
Wichtig scheint uns, dass wir bei solchen Themen besonders darauf achten mit kritischer Distanz zu berichten. Bereits in der Anmoderation haben wir deshalb für unser Publikum die darauffolgenden, kritisierten Bilder eingeordnet und von einer ‘Provokation’, resp. von einem ‘bewusst platzierten’, ‘handfesten Skandal’ gesprochen. Wörtlich sagte die Moderatorin:
Brachiale Beats, die grosse Inszenierung, sie gehören zum Rammstein-Rezept. Und vor allem: Die Provokation. Auch auf dem neusten Album geht’s nicht ohne einen handfesten Skandal, völlig bewusst platziert natürlich.
Dem Publikum war also klar, dass provozierende, ja skandalöse Bilder folgen würden. Die Bilder zu zeigen, war für unsere Berichterstattung durchaus vertretbar, ging es doch im Kern des Berichts gerade eben um die Grenzüberschreitung mittels dieser Bilder. Wir lassen die Bilder aber nicht für sich stehen, sondern zeigen den Gesamtkontext auf und lassen sie von einem Experten einordnen:
Caspar Battegay, Kulturwissenschaftler Universität Basel:
<Wenn man die Szene als Clip allein anschaut und freistellt, finde ich das ist sehr problematisch. Das ist eine Instrumentalisierung des Geschehenen, des Holocausts, der Opfer – das geht überhaupt nicht, weder politisch noch moralisch. Wenn man es im Kontext vom ganzen Film von dem Video anschaut, dann ist es etwas anderes.>
Der Experte kritisiert also deutlich, dass Rammstein den Teaser vorab isoliert publiziert hat. In unserem Bericht haben wir am Ende des Beitrages nochmals klar Stellung zu den Bildern bezogen und deren Effekt für die Band aufgezeigt. Wörtlich:
Hat die Band nun wieder eine Grenze überschritten? Ja. Und das ziemlich plump und berechenbar. Aber schon nur der Verdacht, sie seien irgendwelche Faschisten, erhöht ihre Bekanntheit schlagartig.
Wir haben die Bilder also nicht etwa für sich stehen lassen, sondern sie in einen grösseren Kontext gestellt und kritisch eingeordnet.
Anzumerken ist auch, dass wir in unseren Recherchen durchaus der Frage nachgegangen sind, ob wir die fraglichen Bilder überhaupt zeigen dürfen. Der von uns interviewte Kulturwissenschaftler Caspar Battegay meinte dazu, dass die Gesellschaft heute reif genug sei, die umstrittene Szene im Kontext zu verstehen. Während er die Verwendung der Ausschnitte in der Band-Werbung als Instrumentalisierung kritisiert, bezweifelt er, dass das Rammstein-Video insgesamt verletzend sei. Denn im Video sei die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte klar ersichtlich. Der Holocaust habe eine derart hohe Bedeutung in unserer gegenwärtigen Kultur, dass es laut Battegay absurd gewesen wäre, wenn die Band den Holocaust in dieser kritischen Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte nicht thematisiert hätte.
Wir haben im Vorfeld unserer Berichterstattung auch mit dem Experten Samuel Althof von der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention gesprochen, der selbst Holocaust-Opfer in seiner Verwandtschaft zu beklagen hat. Er selbst ist ein Kind von Shoah-Überlebenden. Er empfand es als unproblematisch, den Videoclip zu zeigen: Die umstrittene Szene sei klar konstruiert, das Publikum könne die Szene einordnen, da sie fiktional sei. Zudem handle es sich nicht etwa um einen Aufruf zu einer Handlung. Hingegen sei es wichtig, dass man den Clip als Ganzes und den Text dazu wahrnehme. Die unmissverständliche Textstelle <Deutschland, meine Liebe kann ich Dir nicht geben> folge umgehend. Samuel Althof sagte auch, das Lied als Ganzes könne gar als Kritik am nationalsozialistischen Gedankengut verstanden werden. Das Spiel mit der Nazi-Ästhetik sei zwar widerlich, die Band erzeuge so Doppelbilder bei den Zuschauern. Aber es stecke keine Programmatik dahinter, kein Mobilisierungscharakter für Rechtsextreme. Samuel Althof hat uns auch auf Nachfrage in diesen Tagen geschrieben, dass aus seiner Sicht die Berichterstattung ‘durchaus kritisch’ sei.
Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass unsere Berichterstattung vertretbar war und gleichzeitig eine kritische Distanz hielt. Weil wir über ein heikles Thema berichteten, haben wir verschiedene Experten um eine Einschätzung gebeten und sie auch auf die kritisierten Bildsequenzen angesprochen. Von keinem Experten kam der Einwand, dass die Ausstrahlung dieser Sequenzen mit einer entsprechenden Einordnung nicht vertretbar wäre. Die Beanstandung hat uns jedoch deutlich vor Augen geführt, was solche Bilder bei einem älteren Publikum auslösen könnte, das die Zeiten des Holocaust noch selbst erlebt hat oder gar direkt davon betroffen war. Das bedauern wir sehr. Wir nehmen die Kritik der Beanstanderin deshalb sehr ernst und werden sie bei unserer künftigen Berichterstattung einfliessen lassen.
Wir bitten Sie, die Beanstandung in diesem Sinne zu beantworten.»
C. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Es ist nicht einfach, hier eine eindeutige Haltung einzunehmen. Man muss unterscheiden zwischen dem Programm der Rockgruppe «Rammstein» und der Sendung. Und man muss unterscheiden zwischen der Kunstfreiheit und dem, was sich aus Gründen der Scham und des Respekts moralisch verbietet. Gehen wir der Reihe nach:
1) Eine Band wie «Rammstein» genießt Kunstfreiheit. Kunst darf, ja muss provozieren. Dabei ist die Grenze zwischen einer Provokation, die das gesellschaftliche Bewusstsein wachrütteln will, und einer Provokation, die lediglich Rockkonzerte bewerben will, fliessend. «Rammstein» setzt beides ein. Das ist der Band unbenommen.
2) Es gibt aber Themen, die sich selbst als Provokation verbieten. Dazu gehört der Holocaust. Der Holocaust ist ein so unvergleichliches Verbrechen und eine derartige Verhöhnung des Menschseins, dass man seiner nur mit Scham und mit tiefem Respekt vor dem jüdischen Volk gedenken kann, dass es aber unerträglich ist, wenn er instrumentalisiert wird. Da «Rammstein» in der Szene mit den KZ-Häftlingen einige von ihnen mit einem Judenstern versehen hat, ist es unausweichlich, dass das Publikum an den Holocaust denkt. Aus diesem Grund halte ich den Videoclip für unerträglich.
3) Medien haben eine Berichterstattungspflicht und eine Kritik- und Kontrollfunktion. Es gehört zu ihrer Aufgabe, auch über Widerwärtiges zu berichten. Beim «Rammstein»-Konzert im Berner Stade de Suisse gab es zwei Gründe für eine Berichterstattung: Erstens war das Konzert ein Publikumsmagnet und damit ein Ereignis, wie überhaupt die Popularität und die Anziehungskraft der Band «Rammstein» ein Medienthema ist. Und zweitens war die Provokation mit der KZ-Szene Anlass für die Medien, das Konzertprogramm von «Rammstein» kritisch zu beleuchten.
4) Man kann daher «10 vor 10» nicht den Vorwurf machen, dass es berichtet hat. Man könnte höchstens den Vorwurf erheben, dass die Berichterstattung zu wenig kritisch war. Das wiederum finde ich aber nicht. Die Botschaft war klar: Rammstein geht zu weit! «10 vor 10» hat damit seine Berichterstattungspflicht erfüllt und seine Kritik- und Kontrollfunktion wahrgenommen. Die Sendung hat daher nicht gegen das Programmrecht verstoßen.
5) Die Frage aber bleibt, was stärker haftet: Die Bilder der Rockband oder die kritischen Einwürfe der Medien. Ich fürchte: die Bilder. Und diese sowie andere Bilder von «Rammstein» können missverstanden werden als Huldigung an die Adresse des Faschismus. Und genau das wäre verheerend.
6) Mit Ihnen bin ich der festen Überzeugung, dass sich etwas Ähnliches wie der Holocaust in den Tausenden von Generationen, die folgen, nie mehr wiederholen darf, und dass deshalb die Erinnerung daran immer und ewig wach bleiben muss – als Mahnung, als Anklage, als Zeichen des Gedenkens an die Opfer, als Kollektivscham. Moralisch haben Sie völlig Recht. Aber formal kann ich Ihre Beanstandung nicht unterstützen, da «10 vor 10» nur der kritische Bote des Unerhörten war, nicht der Verursacher.
D. Diese Stellungnahme ist mein Schlussbericht gemäß Art. 93 Abs. 3 des Radio- und Fernsehgesetzes. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) orientiert die beigelegte Rechtsbelehrung. Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen,
Roger Blum, Ombudsmann
[1] https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/rammstein-im-stade-de-suisse-in-bern?id=546db46c-4e05-4123-ac6f-e814d88ab752
[2] https://www.zeit.de/kultur/musik/2019-03/rammstein-video-deutschland-holocaust
[3] https://www.spiegel.de/kultur/musik/rammstein-kontroverse-um-musikvideo-deutschland-eine-falle-a-1260212.html

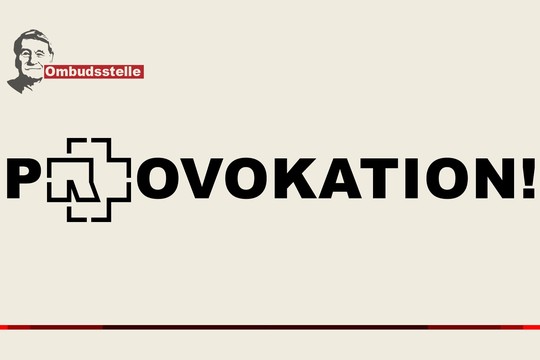

Kommentar