Die «Vier Kräfte» bei SRF – Neue Wege fürs Programm

Das neue Betriebsmodell von SRF, das «Vier-Kräfte-Modell», gibt vor, wie das Radio-/TV- und Online-Programm entsteht, und ist wegweisend in Europa. In dieser Kolumne erläutert Laura Köppen, Abteilungsleiterin Audience, die Hintergründe.
Als im Frühjahr 2020 die Idee des «Vier-Kräfte-Modells» aufkam, ahnte wohl niemand aus dem Projektteam von «SRF 2024», wie weitreichend dieses Modell unser Miteinander verändern würde. Wie stark unsere Arbeitsroutinen, unser Denken, unsere Haltung zueinander gefordert würden. Doch auch nicht, wie zukunftsweisend dieses Modell des Miteinanders für den öffentlichen Rundfunk in Europa ist, wie viel Interesse SRF bei anderen Medienhäusern damit auslöst.
Das «Vier-Kräfte-Modell» führt verschiedene Expertisen zusammen
Was ist nun dieses «Vier-Kräfte-Modell» und was hat es mit dem Programm zu tun? Hinter den «Vier Kräften» stehen die vier Kern-Expertisen, die es für eine professionelle Medienproduktion braucht: Inhalts-, Produktions-, Publikums- und Distributionskompetenz. Dahinter steht auch eine Überzeugung: dass wir in unserer heutzutage hochdynamischen, vernetzten, komplexen Medienwelt nicht allein weiterkommen. Dass wir nur zusammen ein Medienhaus für alle gestalten können.
Vor dem «Vier-Kräfte-Modell» war SRF eine Organisation, in der Expertisen für hochprofessionelle Medienproduktion vorhanden waren, jedoch nicht zwingend zusammenflossen. Publizistische Expertinnen und Experten machten Inhalte. Die Marktforschung erforschte Bedürfnisse und analysierte die Programmnutzung. Ein Bereich verantwortete die Produktion der Formate, die Kanalverantwortlichen planten lineare Kanäle in TV und Radio. Dass die Expertise der Produktion bereits beim Umsetzungsentscheid berücksichtigt wurde, das Wissen der Marktforschung oder die Bedürfnisse digitaler Kanäle in die Programmkonzepte einflossen, war nicht immer gesichert.
Den Service public für die Zukunft rüsten
In einer zunehmend digitalisierten Welt muss sich aber SRF die eigene Relevanz täglich neu erkämpfen. Internationale Streaminganbieter wie Netflix, Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram oder auch TV-Angebote von Telekomunternehmen buhlen um die Aufmerksamkeit und die Zeit des Publikums. Die Auffindbarkeit von SRF-Inhalten ist nicht mehr garantiert. Deshalb war und ist ein Umdenken erforderlich. Um den Service public auch in Zukunft leisten zu können, müssen wir uns schnell anpassen können, Nutzungsbedürfnisse antizipieren, Nutzungswege verstehen.
Wir bei SRF begegnen dieser Komplexität, indem wir Probleme mit allen notwendigen Expertisen im Haus analysieren, Lösungen multiperspektivisch erarbeiten. Das Modell der «Vier Kräfte» sorgt dafür, dass wir Konzepte gemeinsam entwickeln, die Umsetzung gemeinsam entscheiden. Der Literaturpodcast «Zwei mit Buch», das Rechercheformat «SRF Impact Investigativ», der junge Radiokanal «Virus» und die digitale Sport-Comedy «Das VAR’s» sind so entstanden.
Funktioniert das «Vier-Kräfte-Modell» immer reibungslos? Nein. Wir argumentieren, sind uns uneins, fechten manchen Dissens aus. Müssen achtsam sein, aufeinander zugehen, zuhören, unsere Haltung erweitern. Das Miteinander der Kräfte strengt manchmal auch an. Perspektivenvielfalt als Alltagsmodell ist nicht die einfachste Lösung. Doch es ist die beste in einer Zeit, in der uns Silodenken nicht weiterführt. Die «Vier Kräfte» sind nicht «nice to have». Sie sind Notwendigkeit. Voraussetzung für ein Medienhaus für alle, einen Service public, der noch Generationen verbindet, unterhält, inspiriert.

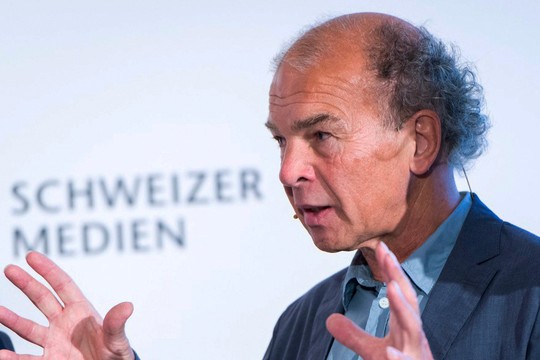

Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.