Dialekt – Identitätshilfe oder soziale Hürde?

Die Schweiz zelebriert ihre sprachliche Vielfalt insbesondere dann, wenn es um ihre Mundart geht. Was bedeutet das in einer Gesellschaft, in der Mobilität zunimmt und eine grosse Minderheit – nämlich Personen mit Migrationshintergrund – keine Mundart beherrscht? Dialekt-Professor Adrian Leemann und sein Team an der Uni Bern berichten aus der aktuellen Forschung.
Die Bundesrätin bestellt beim Bäcker ein Weggli – natürlich auf Dialekt. In weiten Teilen Deutschlands wäre ein solches Szenario praktisch unvorstellbar. Ganz anders hier in der Schweiz, wo die Mundart vergleichsweise hohe Anerkennung geniesst und vom Alltag nicht wegzudenken wäre. Während andernorts Dialekte zu Gunsten einer einheitlichen Sprache verdrängt wurden, setzte man hierzulande immer schon auf die sprachliche Vielfalt.
Gerade die Diversität der deutschen Dialekte auf so kleinem Raum wurde immer wieder als einzigartiges – und demzufolge verbindendes – Identitätsmerkmal zelebriert. Dass dies tief in den Köpfen der Menschen in der Deutschschweiz verankert ist, zeigt auch eine aktuelle Befragung. Dieser zufolge hat die Mundart für die überwiegende Mehrheit der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer einen hohen Stellenwert und die Menschen schätzen es, wenn ihre Herkunft aufgrund der dialektalen Färbung von Fremden erkannt wird. Karte 1 bildet die Resultate zu diesem Dialektstolz ab. Die gelbe bis grüne Einfärbung zeigt an, dass er unter allen Befragten vertreten ist – in keinem einzigen Gebiet ist diese Stimmung wenig bis nicht vorhanden (solche Werte wären orange bis rot eingefärbt). Zudem weist die Karte darauf hin, dass der Dialektstolz im alpinen Raum deutlich ausgeprägter ist als in der nördlichen Deutschschweiz.
So verbindend und identitätsstiftend unsere Mundart auch sein kann, hat auch diese Medaille eine Kehrseite. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass doch einige Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer selbst Ausgrenzung aufgrund ihres Dialekts erleben, wenn sie in eine andere Region ziehen und nicht den lokalen Dialekt sprechen. Eine Umfrage von 2020 bezeugt dies hinsichtlich verschiedener Situationen: Vom Hänseln in der Kindergarten- und Schulzeit, weil man beispielsweise das R nicht rollen kann, bis hin zur Unterschätzung der Fähigkeiten aufgrund der regionalen Herkunft in Studium und Berufsalltag, zeigen sich etliche Beispiele dieser «internen» Dialektdiskriminierung. Die meisten Betroffenen stammen dabei aus der Zentral- und Ostschweiz. Diese starke Gruppenzugehörigkeit, die ausgeprägte Koppelung zwischen Dialektstolz und Identität, ist etwas Urschweizerisches. Möglicherweise führt diese aber dazu, dass Personen ausserhalb dieser Gruppe benachteiligt werden. Studien aus England zeigen, dass man einer solchen Bevor- beziehungsweise Benachteiligung aufgrund des Dialekts aktiv entgegenwirken kann, indem in beruflichen Situationen (z. B. bei Vorstellungsgesprächen) darauf geachtet wird, nur die Kompetenzen der Kandidatin oder des Kandidaten zu beurteilen und Merkmale wie beispielsweise den Dialekt nicht zu beachten.
Erstklassige Hochdeutschkenntnisse nützen einem wenig, wenn man in der Kaffeepause sitzt und der neuste Klatsch und Tratsch im Dialekt zum Besten gegeben wird.
Eine zweite negative Auswirkung des Dialektstolzes ist an unsere heutige Gesellschaft geknüpft, die viel diverser ist als noch vor einigen Jahrzehnten. Rund ein Viertel der heutigen Schweizer Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Neuzuziehende Migrantinnen und Migranten sprechen zwar oft Hochdeutsch, jedoch keinen Dialekt, was sie vor grosse Herausforderungen stellt. In der Deutschschweiz haben wir eine sogenannte Diglossie-Situation, wo Dialekte und Standardsprache nebeneinander existieren und beide in je bestimmten Bereichen eingesetzt werden (Griechisch di = zwei, glõssia = Sprachen). Dieses Phänomen ist an sich keine Seltenheit und existiert in vielen anderen Ländern auch. Die besondere Herausforderung in der Deutschschweiz besteht unter anderem aber darin, dass die Dialekte nicht nur den privaten, familiären Raum einnehmen, sondern zumindest im mündlichen Bereich oft auch in formellen Kontexten, wie beispielsweise am Arbeitsplatz, dominieren. Wer also im Alltag bestehen will, muss sozusagen zwei Varianten einer Sprache beherrschen statt nur eine. Zudem sind diese zwei Varianten sprachlich vergleichsweise weit voneinander entfernt. Erstklassige Hochdeutschkenntnisse nützen einem daher wenig, wenn man mit Deutschschweizer Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeepause sitzt und der neuste Klatsch und Tratsch im Dialekt zum Besten gegeben wird. Hinzu kommt, dass ja auch die Mundarten untereinander sehr unterschiedlich sind und nicht selten ein paar Kilometer weiter nicht mehr gilt, was man vorher gelernt hat. Wer also zum Beispiel mit Stolz aufgeschnappt hat, dass eine Schale im Berndeutschen nicht nur ein Gefäss, sondern auch ein Milchkaffee ist, wird mit diesem Insiderwissen beim nächsten Urlaub im Wallis kaum punkten. Dies ist ein harmloses Beispiel. Zahlen des Bundesamts für Statistik sind da etwas ernüchternder und zeigen, dass stereotype Zuschreibungen weit über die ersten Begegnungen mit Dialekten eine Rolle spielen: Rund jede zehnte Person wurde in der Schweiz bereits aufgrund der Sprache oder des Akzents diskriminiert. In den meisten Fällen (bei mehr als 50%) wird am Arbeitsplatz diskriminiert.
Welche Strategien gibt es denn, um in diesem Verhältnis der gesellschaftlichen Zweisprachigkeit zu überleben? Eine Mischform zwischen Dialekt und Hochdeutsch zu wählen, ist schwierig, gerade weil Dialekt und Hochdeutsch in der Deutschschweiz sehr unterschiedlich sind und je nach Situation unterschiedliche Verwendungen finden. Stimmungsbarometer von Tamedia weisen darauf hin, dass rund 15 Prozent der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer finden, deutsche Einwanderer sollen Schweizerdeutsch lernen; rund die Hälfte der Befragten fand aber, dass jede/r so sprechen soll, wie ihm/ihr der Schnabel gewachsen ist. Auf die Frage, mit welcher Sprache sich Deutschschweizerinnen mit deutschen Einwanderern unterhalten, meinte rund die Hälfte, dass sie Schweizerdeutsch sprechen. Die andere Hälfte entscheidet eher von Fall zu Fall, ob Dialekt oder Hochdeutsch gesprochen wird. Kleine Prozentsätze sprechen kompromisslos Hochdeutsch oder Dialekt. Daraus schliessen wir, dass die wahrscheinlich sinnvollste Strategie für deutsche Einwanderer das Erlernen des Dialekts auf der Verständnisebene ist; ein Erlernen des Dialekts auf der Sprechebene kann für viele Erwachsene nervenaufreibend und zeitintensiv sein.
Nicht nur die Erwachsenen im Berufsleben haben mit dieser Sondersituation Dialekt vs. Hochdeutsch umzugehen, sondern auch Jugendliche. Es scheint aber so, dass Jugendliche – die sprachlich noch flexibler sind – sich damit auf kreative Art und Weise auseinandersetzen. Vor allem im Bereich der Jugendsprache sehen wir Einflüsse des Migrationshintergrundes auf den Dialekt: So zum Beispiel sprechen Jugendliche mit Migrationshintergrund (aus Balkanstaaten) eher im Staccato-Rhythmus. Auch gewisse Konsonanten, wie im Wort «Brüeder», werden von Jugendlichen oft anders ausgesprochen. Weitere Merkmale sind beispielsweise das Auslassen des Artikels – «Max chunt hüt au» – oder das Auslassen von Funktionswörtern – «Gömmer Bahnhof?». Diese neuen Einflüsse werden teilweise auch von jungen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern ohne Migrationshintergrund übernommen und sorgen für neue Diversität in unseren Mundarten.
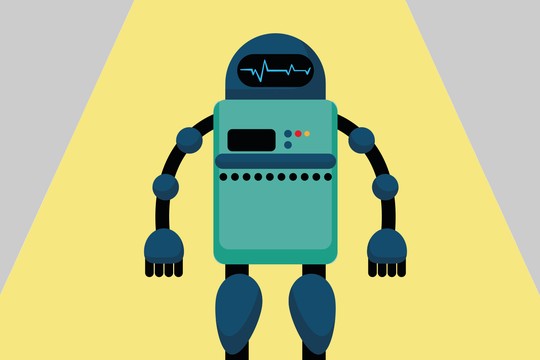


Kommentar
Kommentarfunktion deaktiviert
Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.